Ratgeber zum Thema
Symptome im Überblick

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel
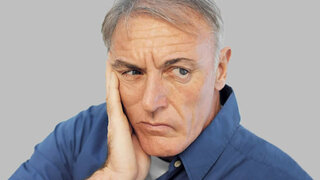
zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel
Diagnoseverfahren

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel
Verschiedene Behandlungsverfahren

zum Artikel

zum Artikel
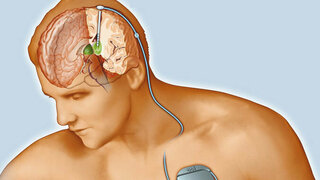
zum Artikel
zum Artikel

zum Artikel
Informationen in Einfacher Sprache

zum Artikel

zum Artikel
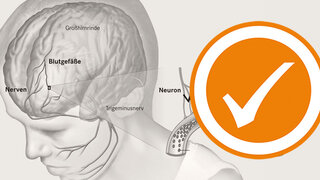
zum Artikel
Weitere Artikel

zum Artikel

zum Artikel
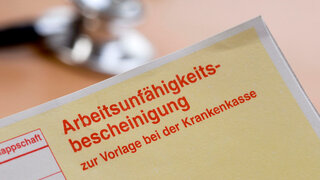
zum Artikel


