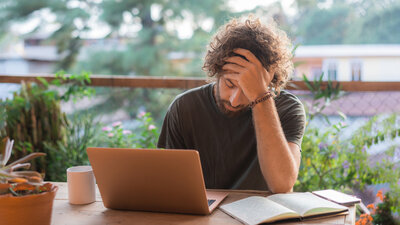Müdigkeit: Können Krankheiten schuld sein?

Ständige Müdigkeit: Ein möglicher Grund sind die Schlafgewohnheiten.
© Duet Postscriptum / Stocksy United
Wann ist Müdigkeit nicht mehr normal?
Jeder ist ab und zu mal müde – weil er vielleicht schlecht geschlafen hat, gerade eine Erkältung durchmacht, vorübergehend gestresst ist oder sich körperlich verausgabt hat. Meistens ist das kein Grund zur Sorge. Ausreichend Ruhe, Erholung und Schlaf laden die Batterien rasch wieder auf. In harmlosen Fällen helfen vielleicht schon einfache Tipps gegen Müdigkeit oder mehr Pausen im Alltag.
Wann Müdigkeit auffällig wird, ist nicht exakt definiert. Folgende Punkte deuten darauf hin, dass die Erschöpfung ein normales Maß übersteigt:
- Betroffene sind über längere Zeit ständig müde, schlapp, antriebslos oder rasch erschöpft.
- Der Energiemangel bessert sich nicht durch Ausruhen oder Schlafen.
- Alltagsaktivitäten aufzunehmen oder durchzuhalten, fällt schwer. Eventuell kommt es zu einem Leistungsknick im Beruf oder im Privatleben.
- Betroffene fühlen sich schwach und kraftlos.
- Gedächtnis und Konzentration können beeinträchtigt sein.
- Die Stimmung kann gedrückt oder von Lustlosigkeit und Gereiztheit geprägt sein.
- Die ständige Müdigkeit hat keine erkennbare Ursache, wie zum Beispiel eine Atemwegsinfektion, die der Körper gerade bekämpft, oder eine stressreiche Lebensphase. Oder eine solche Episode ist eigentlich vorüber, doch die Müdigkeit klingt einfach nicht ab.
Chronische Müdigkeit nennen Fachleute eine Müdigkeit, die länger als sechs Monate[1] anhält.
Fatigue wird eine extreme Müdigkeit und anhaltende Erschöpfung genannt, oft im Zusammenhang mit Krankheiten.
Müde oder schläfrig?
Manchmal wird Müdigkeit mit Schläfrigkeit gleichgesetzt. Dieser Begriff beschreibt eher ein erhöhtes Schlafbedürfnis, auffällig lange Schlafenszeiten oder die Neigung, tagsüber ungewollt einzuschlafen – vor allem bei monotonen Tätigkeiten wie Lesen oder Fernsehen. Auch eine Schläfrigkeit sollte ärztlich abgeklärt werden.
Wann zum Arzt oder zur Ärztin?
Wer den Eindruck hat, dass seine Müdigkeit ein normales Maß übersteigt oder den Alltag in ungewohnter Weise beeinträchtigt, sollte sich vorsichtshalber ärztlich untersuchen lassen. Das gilt auf jeden Fall, wenn zusätzliche Symptome auftreten, für die keine Ursache bekannt ist, beispielsweise Fieber, Nachtschweiß, Schmerzen, Lymphknotenschwellungen oder ein Verlust von Körpergewicht, der nicht zum Beispiel durch eine Diät erklärbar ist.
Häufig hat Müdigkeit etwas mit dem persönlichen Lebensstil oder der aktuellen Lebenssituation zu tun. Manchmal stecken hinter Müdigkeit aber auch Krankheiten – psychische oder körperliche. Auch bei hartnäckigen Schlafproblemen ist eine ärztliche Beratung empfehlenswert.
Erste Anlaufstelle ist üblicherweise die hausärztliche Praxis. Die Ärztin oder der Arzt kann untersuchen, welche Gründe die Erschöpfung haben könnte. Nicht in jedem Fall ist es möglich, die exakte Ursache der Müdigkeit zu bestimmen.
Was sind mögliche Gründe für Müdigkeit?
Hinter Müdigkeit können viele Ursachen stecken. Sie können sich auch überschneiden. Die folgende Liste nennt nur Beispiele, sie ist nicht vollständig:
- Schlafgewohnheiten: Wir haben selbst einen gewissen Einfluss auf die Menge und die Qualität unseres Schlafs. Manche Menschen schieben zum Beispiel das Schlafengehen abends zu lange auf und schlafen deshalb zu wenig. Einfache Regeln der Schlafhygiene wirken häufigen Schlafproblemen und damit verbundener Müdigkeit entgegen. Bei anhaltenden Schlafstörungen ist eine ärztliche Beratung sinnvoll.
- Lebensstil und Lebensumstände: Manche Lebensstilfaktoren können Müdigkeit fördern. Zum Beispiel wird Bewegungsmangel mit Müdigkeit in Verbindung gebracht[2]. Beides kann sich gegenseitig verstärken: Wer länger inaktiv ist, baut körperlich ab. Aktivitäten fallen schwerer, was die Lust auf Bewegung weiter dämpft und wiederum die Müdigkeit steigert. Es kann also helfen, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen. Wer älter als 35 Jahre oder chronisch krank ist und neu oder nach längerer Pause sportlich aktiv wird, sollte sich vorab ärztlich zum individuell passenden Trainingspensum beraten lassen. Ein weiterer Grund für Müdigkeit kann der Missbrauch von Substanzen wie Alkohol sein. Auch Überlastung und Arbeitsfrust, Sorgen oder Krisen oder zu wenig Entspannung können zu Erschöpfung führen.
- Medikamente: Müdigkeit kann eine Nebenwirkung von Medikamenten sein. Das kommt beispielsweise bei Medikamenten gegen Depressionen oder Beruhigungsmitteln vor. Wer einen entsprechenden Verdacht hat, sollte verordnete Arzneimittel nicht in Eigenregie absetzen, sondern mit der Ärztin oder dem Arzt darüber sprechen. Eventuell gibt es Alternativen.
Kann Müdigkeit ein Symptom von Krankheiten sein?
Fast jede Krankheit kann – neben krankheitstypischen Beschwerden – auch Müdigkeit verursachen. Das Symptom muss aber nicht in jedem Fall auftreten. Dass eine bestimmte Krankheit bekannt ist, muss außerdem nicht heißen, dass sie tatsächlich der Grund für eine Müdigkeit ist. Nur die Ärztin oder der Arzt kann feststellen, was hinter einer unklaren Müdigkeit steckt. Deshalb ist eine ärztliche Beratung sinnvoll. So lassen sich mögliche Auslöser eingrenzen oder auch ausschließen.
Einige Beispiele für Erkrankungen, die Müdigkeit auslösen können:
- Psychische Erkrankungen: Ständige Müdigkeit kann auf eine Depression hindeuten. Auch Angststörungen können hinter einer Erschöpfung stecken. Suchterkrankungen, wie Alkoholsucht oder Drogenmissbrauch, sind ebenfalls manchmal mit Müdigkeit verbunden.
- Infektionskrankheiten: Vor allem durch Viren verursachte Infekte können mit Müdigkeit verknüpft sein – etwa eine Erkältung oder eine Grippe. Die Virusinfektion Mononukleose, auch Pfeiffersches Drüsenfieber genannt, führt öfter zu längerer Erschöpfung. Nach der Coronavirus-Infektion Covid-19 leiden manche Menschen unter längerer Müdigkeit.
- Schlafstörungen: Bei der Schlafapnoe kommt es zu unbemerkten nächtlichen Atemaussetzern, oft verbunden mit Schnarchen. Ein- und Durchschlafstörungen sind typisch für eine Insomnie. Beide Schlafstörungen können zu Müdigkeit führen.
- Lebererkrankungen, wie eine Hepatitis, können müde machen.
- Blutarmut, Eisenmangel: Unser Körper braucht Eisen, um rote Blutkörperchen zu bilden. Sie transportieren den Sauerstoff. Kommt es zu einem Eisenmangel, entsteht womöglich eine Blutarmut. Der Körper wird dann schlechter mit Sauerstoff versorgt. Eine Blutuntersuchung kann zeigen, ob im Körper ausreichend Eisen vorhanden ist. Daneben gibt es weitere Gründe für eine Blutarmut.
- Manche Herzkrankheiten, etwa eine Herzschwäche, können neben anderen möglichen Beschwerden auch Müdigkeit auslösen.
- Schilddrüsenerkrankungen: Müdigkeit weist manchmal auf Krankheiten der Schilddrüse hin, zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion.
- ME/CFS: Die Abkürzung steht für die eher seltene Myalgische Enzephalomyelitis /Chronisches Fatigue Syndrom.
- Krebserkrankungen, Tumore: Eher selten steckt hinter Müdigkeit eine Krebserkrankung. Oft sind dann weitere Symptome vorhanden. Umgekehrt berichten Menschen mit Krebs häufig über Müdigkeit – Fatigue genannt. Informationen zu Fatigue bei Krebs bietet etwa der Krebsinformationsdienst.
Wichtig: Die Liste möglicher Ursachen ist nicht komplett. Es handelt sich nur um eine Auswahl.
Was hilft bei Müdigkeit?
Es gibt zahlreiche Gründe für eine übermäßige Müdigkeit. Die Ärztin oder der Arzt kann untersuchen, ob eine Behandlung nötig ist und was sie gegebenenfalls beinhaltet.
Je nach Fall kann zum Beispiel auch abwartendes Beobachten mit fest vereinbarten ärztlichen Kontrollterminen sinnvoll sein, eine Veränderung des Lebensstils, ein angepasstes Bewegungsprogramm oder eine Verhaltenstherapie.
Wichtiger Hinweis
Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Fragen beantworten.
Quellen:
- [1] Maisel P, Baum E, Donner-Banzhoff N: Leitsymptom Müdigkeit: Epidemiologie, Ursachen, Diagnostik und therapeutisches Vorgehen. Dtsch Arztebl Int 2021; 118: 566–76. : https://www.aerzteblatt.de/... (Abgerufen am 10.04.2024)
- [2] Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. (DEGAM) : S3-Leitlinie Müdigkeit. Leitlinie: 2022. https://register.awmf.org/... (Abgerufen am 04.04.2024)
- Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP): S1-Leitlinie Long/ Post-COVID - Living Guideline. Leitlinie: 2021. https://register.awmf.org/... (Abgerufen am 04.04.2024)
- Fosnocht K M, MD, Ende J, MD: Approach to the adult patient with fatigue. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com : https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 09.04.2024)
- Chervin R D, MD, MS: Approach to the patient with excessive daytime sleepiness. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com : https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 09.04.2024)
- Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com : Patient education: Daytime sleepiness (The Basics). https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 09.04.2024)
- Gluckman S J, MD: Clinical features and diagnosis of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com : https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 23.04.2024)
- Gluckman S J, MD: Patient education: Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (Beyond the Basics). Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com : https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 23.04.2024)