Pflegegrade und Anträge
Was ist ein Pflegegrad? Wie beantrage ich ihn? Und wie wird festgelegt, welche Hilfen mir zustehen? Hier finden Sie Antworten auf Ihre Fragen zum Artikel




Pflegegrade und Anträge
Was ist ein Pflegegrad? Wie beantrage ich ihn? Und wie wird festgelegt, welche Hilfen mir zustehen? Hier finden Sie Antworten auf Ihre Fragen zum Artikel

Pflege zuhause
Jeder kann von heute auf morgen ein Pflegefall werden. Oft pflegen dann die Angehörigen den Betroffenen in den eigenen vier Wänden. Welche Hilfsangebote und Möglichkeiten der Unterstützung es gibt zum Artikel

Pflege im Heim
Der Umzug ins Pflegeheim ist für Betroffene und Angehörige ein großer Schritt. Wie Sie das richtige Heim finden und wie die Eingewöhnung klappt, lesen Sie hier zum Artikel
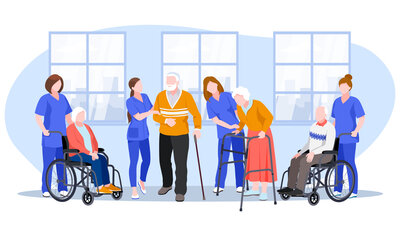
Hilfsmittel und Leistungen
Inkontinenzmittel, Rollstuhl, Duschhocker – sie alle gehören zur breiten Palette von Hilfsmitteln, die die Kasse übernimmt. Wie Sie die passende Versorgung für sich oder Ihren pflegebedürftigen Angehörigen erhalten zum Artikel

Pflegetipps
Wie lagert man einen bettlägerigen Pflegebedürftigen? Wie geht man am besten mit Menschen mit Demenz um? Hier lesen Sie konkrete Ratschläge für den Pflege-Alltag zum Artikel

Erfahrungsberichte
"Ich pflege..." - Lesen Sie hier die Protokolle von Pflegenden, die ihre Erfahrungen, Nöte und Wünsche schildern zum Artikel

Selbstfürsorge
Einen Menschen zu pflegen kann eine erfüllende Erfahrung sein - ist aber auch sehr anstrengend. Hier finden pflegende Angehörige Ratschläge, wie sie auch für sich selbst sorgen zum Artikel
Die Anzeige der externen Inhalte wurde von Ihnen im Consent abgewählt.
Wollen Sie die Inhalte doch angezeigt bekommen?