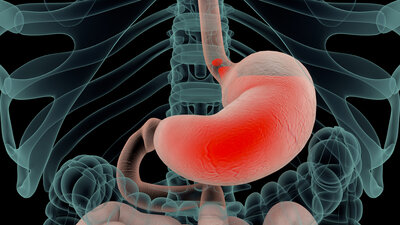Sodbrennen: Mögliche Ursachen und Hilfe

Hat man viel gegessen, entsteht Druck auf den Magen: In der Folge kann Säure nach oben gelangen und Sodbrennen auslösen.
© Shutterstock/GBALLGIGGSPHOTO
Was ist Sodbrennen?
Beim Sodbrennen gelangt Magensäure in die Speiseröhre, manchmal sogar ein Teil der zu sich genommenen Nahrung. Solch einen Rückfluss bezeichnet man in der Medizin als Reflux.
Vor allem, wenn das Essen sehr üppig und fettreich ist, kann es plötzlich zu Sodbrennen kommen: Man spürt dann ein brennendes Gefühl in der Gegend um das Brustbein, mitunter bis hinauf zum Rachen. Manchmal drückt es zusätzlich im Magen. Oft ist das Sodbrennen mit Aufstoßen verbunden.
Manche Menschen verspüren Sodbrennen, wenn sie Getränke mit viel Säure oder Koffein trinken oder gestresst sind. Einige kämpfen weniger mit brennenden Schmerzen und sind stattdessen heiser, müssen sich häufig räuspern oder immer wieder husten – vor allem morgens. Ebenso kann es in der Schwangerschaft oder bei Menschen mit Übergewicht vermehrt zu Sodbrennen kommen.
Besteht das Sodbrennen vorübergehend, hilft es meist, den Auslöser zu vermeiden. Kommt Sodbrennen regelmäßig vor, ist eine ärztliche Abklärung wichtig.
Wie kommt es zum Reflux?
Normalerweise verhindert ein Schließmuskel zwischen Magen und Speiseröhre, dass Magensäure nach oben gelangt. Ist das Essen fettreich, entleert sich der Magen verzögert und bleibt daher länger voll. Sitzt dann zum Beispiel die Kleidung zu eng, kann es passieren, dass ein Druck auf den Magen entsteht, dem der Schließmuskel nicht standhalten kann.
Darüber hinaus gibt es Faktoren, die den Schließmuskel selbst beeinträchtigen, sodass dieser nicht mehr wie üblich schließt. Dazu zählen zum Beispiel Genussgifte wie Nikotin, verschiedene Medikamente oder bestimmte Erkrankungen.
Wann sollte man mit Sodbrennen zum Arzt oder zur Ärztin gehen?
Ein gelegentliches Sodbrennen ohne Begleitsymptome, beispielsweise nach dem Essen, ist unbedenklich und legt sich meist rasch wieder. Hat man regelmäßig mit Sodbrennen zu tun, liegt der Verdacht auf eine Erkrankung wie die Refluxkrankheit nahe. Dabei fließt anhaltend Magensäure in die Speiseröhre zurück, was sich durch Sodbrennen äußert und unbehandelt ernste Folgen haben kann. Um dem vorzubeugen, ist ein Besuch beim Hausarzt oder bei der Hausärztin wichtig.
Auch regelmäßiger Reizhusten kann Zeichen von Sodbrennen sein. Tritt dieser auf, ohne dass es Hinweise auf mögliche Ursachen gibt, ist es ratsam, das ärztlich abklären zu lassen.
Wichtig: Brennen hinter dem Brustbein kann ein Symptom eines Herzinfarkts sein – insbesondere, wenn Risikofaktoren wie Diabetes oder Bluthochdruck bestehen. Vor allem, wenn das Brennen erstmals auftritt und weitere Symptome dazukommen wie Übelkeit, Blässe, Schweißausbruch und Kreislaufschwäche, ist sofort ärztliche Hilfe unter der Notrufnummer 112 anzufordern.
Welche Ursachen kann Sodbrennen haben?
Es gibt eine Reihe von Krankheiten, die mit Sodbrennen einhergehen können – hauptsächlich sind es Erkrankungen des Magens und der Speiseröhre. Außerdem spielt der Lebensstil, die Einnahme bestimmter Medikamente und Schwangerschaft eine Rolle.
Erkrankungen als Auslöser
Zu den Erkrankungen, die Sodbrennen auslösen können, gehören unter anderem:
- gastroösophageale Refluxkrankheit
- Speiseröhrenentzündung (Ösophagitis)
- Probleme mit dem Schließmuskel der Speiseröhre, zum Beispiel die Achalasie: Das ist eine seltene Erkrankung, bei der die Beweglichkeit von Schließmuskel und Speiseröhre gestört ist.
- Zwerchfellbruch (Hiatushernie)
- Reizmagen
- Magenschleimhautentzündung
- Magengeschwür
- Nahrungsmittelunverträglichkeiten
- Übergewicht
Lebensstil als Auslöser
Zu den nicht krankheitsbedingten Faktoren, die Sodbrennen fördern, zählen beispielsweise:
- Verzehr üppiger, fetter oder saurer Speisen
- Konsum koffein- oder säurehaltiger Getränke
- Rauchen und Alkoholgenuss
- Nervosität, Stress, seelische Belastungen
- enge Kleidung
Medikamente als Auslöser
Verschiedene Arzneimittel können einen Reflux auslösen oder begünstigen, etwa:
- bestimmte Mittel gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma, Osteoporose und Rheuma
- Schmerzmittel wie Acetylsalicylsäure (ASS), Ibuprofen und Diclofenac
- hormonelle Präparate gegen Beschwerden nach den Wechseljahren
- Medikamente zur Krebsbehandlung (Zytostatika)
- Beruhigungsmittel wie Benzodiazepine
- bestimmte Antibiotika
- Arzneimittel, die Pfefferminzöl enthalten
Wichtig: Wenn Sie einen Zusammenhang vermuten zwischen dem Sodbrennen und einem Medikament, das Sie einnehmen, setzen Sie das Medikament nicht von allein ab. Sprechen Sie dazu mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und beraten Sie gemeinsam, welche alternativen Behandlungsmöglichkeiten es gibt.
Schwangerschaft als Auslöser
Sodbrennen ist vor allem im letzten Drittel der Schwangerschaft ein Problem. Denn dann passiert es öfter mal, dass das Kind auf den Magen drückt und es so zu Sodbrennen kommt. Zudem bewirken die erhöhten Hormonspiegel bei Schwangeren, dass viele Gewebe lockerer werden. Das betrifft auch den Schließmuskel an der Speiseröhre: Dieser schließt dann nicht mehr gut genug, sodass Magensäure in die Speiseröhre gelangen kann.
Was kann man gegen Sodbrennen tun?
Ist eine Erkrankung der Grund für das Sodbrennen, muss diese entsprechend behandelt werden. Stellt sich Sodbrennen nur gelegentlich ein, genügt es meist, die Lebens- und Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Das bedeutet zum Beispiel:
- üppige Speisen meiden und stattdessen mehrere kleine Mahlzeiten zu sich nehmen
- auf Getränke wie Kaffee oder Alkohol verzichten, die dem Magen „sauer aufstoßen“ können
- nicht rauchen: Fällt der Rauchstopp schwer, gibt es verschiedene Möglichkeiten der unterstützenden Raucherentwöhnung.
- sich bequem kleiden und Gürtel nicht zu eng schnallen
- Übergewicht vermeiden oder durch ausgewogene Ernährung reduzieren
- Stress abbauen: Neben Entspannungstechniken kann auch eine psychotherapeutische Betreuung hilfreich sein.
- möglichst spät abends nichts mehr essen, mit erhöhtem Kopf und bevorzugt auf der linken Körperseite schlafen: Das gilt vor allem bei nächtlichen Beschwerden.
Was hilft sofort bei Sodbrennen?
Verspürt man nach einem üppigen Essen ein Brennen hinter dem Brustbein und muss vermehrt aufstoßen, hilft am besten ein Verdauungsspaziergang. Sich hinzulegen ist weniger ratsam, denn dadurch verstärken sich in der Regel die Beschwerden.
Gibt es Medikamente gegen Sodbrennen?
Wenn neben dem typischen Sodbrennen keine weiteren Beschwerden bestehen, können Anti-Reflux-Präparate zum Einsatz kommen. Dazu gehören etwa:
- Antazida: Das sind Medikamente, die die Magensäure binden und so Sodbrennen reduzieren können. Sie eignen sich bei leichten Beschwerden. Antazida sind ohne Rezept erhältlich. Lassen Sie sich vor der Einnahme ärztlich oder in der Apotheke darüber aufklären, wie man die Medikamente richtig anwendet.
- Protonenpumpenhemmer (PPI): Wirkstoffe wie Omeprazol und Pantoprazol blockieren die Bildung von Magensäure und lindern so die Beschwerden. Ärztinnen und Ärzte können sie bei stärkerem Sodbrennen verschreiben. Zum kurzfristigen Gebrauch sind die Mittel auch ohne Rezept erhältlich. Lassen Sie sich in der Apotheke beraten, ob Sie für Ihr Problem eine Lösung sind.
Wichtiger Hinweis
Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Fragen beantworten.
Quellen:
- Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten e. V. (BDI): Sodbrennen: Behandlung. internisten-im-netz.de: https://www.internisten-im-netz.de/... (Abgerufen am 11.03.2024)
- Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten e. V. (BDI): Tipps gegen Sodbrennen. internisten-im-netz.de: https://www.internisten-im-netz.de/... (Abgerufen am 11.03.2024)
- Pschyrembel online: Sodbrennen. https://www.pschyrembel.de/... (Abgerufen am 11.03.2024)
- S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten e. V. (DGVS): Gastroösophageale Refluxkrankheit und eosinophile Ösophagitis. Leitlinie: 2023. https://register.awmf.org/... (Abgerufen am 11.03.2024)