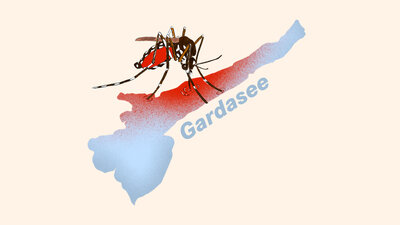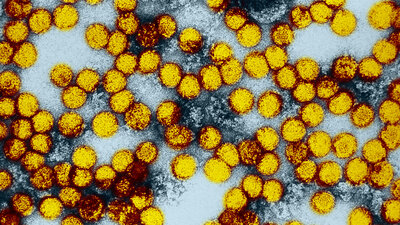Denguefieber

Die Gelbfieber-Mücke (Stegomyia aegypti) kann das Denguevirus übertragen.
© Schmidbauer, H./juniors@wildlife
Was ist das Denguefieber?
Das Denguefieber ist eine Viruserkrankung, die durch bestimmte Mückenarten, die sogenannten Tiger-Mücken (Aedes, Synonym: Stegomyia), übertragen wird. Das Denguefieber gilt mit geschätzt mehr als circa 400 Millionen Fällen weltweit [1]als die häufigste, durch Moskitos übertragene Viruserkrankung und zählt zu den häufig importierten viralen Infektionen auch bei deutschen Reiserückkehrern.
Dengueviren (Familie: Flaviviren) lassen sich in vier verschiedene Untergruppen (Serotypen) einteilen. Diese werden als DENV-1 bis DENV-4 bezeichnet. Die Infektion mit einem der vier Typen hinterlässt zwar eine Immunität gegen den entsprechenden Serotyp, sowie vermutlich kurzzeitig gegen die restlichen drei. Langfristig scheint dies allerdings nicht vor weiteren Infektionen mit den anderen Serotypen zu schützen, sondern könnte sogar eine schwerere Verlaufsform begünstigen, da einige Daten darauf hinweisen, dass schwerere Verläufe häufiger bei erneuten Infektionen mit einem der anderen Serotypen auftreten. Die Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit (DTG) rät nicht dazu nach einer durchgemachten Infektion auf weitere Reisen in Risikogebiete zu verzichten.[2]
Verbreitung: Wo und wie häufig gibt es Denguefieber?
Denguefieber gilt als die häufigste durch Stechmücken übertragene virale Erkrankung. Sie kommt vor allem in tropischen und subtropischen Regionen vor: Etwa in Südostasien, Teilen von Asien (Indien, Pakistan, Afghanistan), Süd- und Mittelamerika, Afrika und Australien.
Seit 2007 gilt das Denguefieber auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira als endemisch, über eintausend Personen erkrankten dort im Jahre 2012.
Die meisten in Europa gemeldeten Fälle von Denguefieber stehen im Zusammenhang mit Reisen in die Verbreitungsgebiete. In den letzten Jahren kommt es aber immer wieder auch zu vereinzelten Ansteckungen innerhalb Europas, etwa in Frankreich, Italien oder Spanien. [3]Durch die globale Erwärmung und die damit verbundene weitere Verbreitung der Überträgermücken rechnen Experten mit einem vermehrten Auftreten von Denguefieber in bisher nicht betroffenen Gebieten.[4]
Eine Karte der Risikogebiete für eine Denguevirus-Infektion finden Sie hier.
Ursachen: Wie wird Denguefieber übertragen?
Das Virus wird fast ausschließlich durch einen Überträger (Vektor) verbreitet. Hierbei handelt es sich um verschiedene Mückenarten. Am weitesten verbreitet ist hier die Gelbfieber-Mücke (Stegomyia aegypti), auch ägyptische Tigermücke genannt (siehe Abbildung). In manchen Regionen spielen auch die asiatische Tigermücke (Stegomyia albopictus) oder die polynesische Tigermücke (Stegomyia polynesiensis) eine wichtige Rolle.
Vor allem die asiatische Tigermücke hat ihren Wirkraum in den letzten Jahren auf Europa ausgedehnt. Bei mehreren anderen Mückenarten konnte inzwischen nachgewiesen werden, dass sie für eine mögliche Übertragung des Virus geeignet wären.
Die Mücken kommen vor allem in der Umgebung menschlicher Besiedlung vor. So verbreiten sie das Denguevirus besonders im städtischen Raum. Sie legen ihre äußerst widerstandsfähigen Eier nahe kleiner Wasseransammlungen ab – finden zum Beispiel in Eimern, Flaschen, alten Autoreifen oder Regentonnen ideale Brutplätze. Infizierte Weibchen können den Erreger direkt an ihre Nachkommen weitergeben.
Die Übertragung des Denguevirus erfolgt beim Stich weiblicher infizierter Mücken. Nicht infizierte Mücken können sich beim Blutsaugen an einem infizierten Menschen "anstecken".
Meist stechen die Mücken tagsüber, bevorzugt in den Morgen- und Abendstunden und oft mehrmals. Männliche Mücken können das Virus nicht übertragen, da sie kein Blut saugen.

Die Gelbfieber-Mücke (Stegomyia aegypti) kann das Denguevirus übertragen.
© Schmidbauer, H./juniors@wildlife
Symptome des Denguefiebers
Man unterscheidet zwischen dem klassischen Verlauf des Denguefiebers und dem hämorrhagischen Denguefieber/Dengue-Schock-Syndrom. Die meisten Infektionen verlaufen jedoch ohne Symptome. Die Inkubationszeit dauert zwischen drei und vierzehn Tagen, durchschnittlich beträgt sie zwischen vier und sieben Tage.
Klassischer Verlauf: Im klassischen Fall tritt innerhalb weniger Tage nach der Infektion schlagartig hohes Fieber bis 40°C auf. Typisch sind stärkste Muskel-, Gelenkschmerzen und Knochenschmerzen, häufig auch Kopfschmerzen oder ein Druckschmerz hinter dem Auge. Gelegentlich kann der Betroffene aufgrund der Schmerzen nicht mehr gehen oder stehen.
Begleitend können allgemeine Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Verstopfung oder Durchfälle, Husten und Lymphknotenschwellung auftreten. Es besteht ein schweres Krankheitsgefühl. Eine rötliche Färbung der gesamten Haut (Erythem) ist zu Beginn häufig zu beobachten.
In vielen Fällen sinkt das Fieber nach zwei bis drei Tagen kurzzeitig ab, um dann erneut anzusteigen. Wenige Tage nach Krankheitsbeginn zeigt sich bei vielen Erkrankten ein kleinfleckiger rötlicher Ausschlag mit ausgeprägtem Juckreiz, der sich von alleine zurückbildet. Gelegentlich kann es zu Nasen- oder Zahnfleischblutungen kommen.
Üblicherweise klingen alle Symptome im Verlauf einer Woche ohne Folgeschäden ab. Es kann jedoch zu einer noch Wochen andauernden Schwäche mit Erschöpfungsgefühl kommen.
Hämorrhagisches Denguefieber / Dengue-Schock-Syndrom: Vor allem bei Kindern kommt dieser schwere Verlauf vor. Er macht insgesamt etwa ein bis fünf Prozent aller Fälle aus. Die Muskel-, Gelenk- und Knochenschmerzen können hier fehlen. Nach wenigen Tagen kommt es zu einer plötzlichen Verschlechterung mit Blutungen, insbesondere im Hautbereich, und starkem Abfall der Zahl der Blutplättchen (Thrombozyten). Durch Blutungen im Magen-Darm-Bereich kann es zu Bluterbrechen und blutigem Stuhlgang kommen. Häufig sind Nasen- und Zahnfleischbluten. In den meisten Fällen normalisiert sich die Blutgerinnung nach wenigen Tagen wieder.
Theoretisch sind Blutungen in allen Organen des Körpers möglich (zum Beispiel in Lunge oder Gehirn). Bei den schweren Verlaufsformen kommt es zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Gefäßwände für Flüssigkeiten (capillary leak). Dieses Leck der Kapillarwände führt zu einem großen Flüssigkeitsverlust von den Gefäßen in den Körperraum, so dass es zu einem Volumenmangel innerhalb der Gefäße kommt. Ohne Therapie droht ein lebensgefährlicher Schock mit Kreislaufversagen.
Die WHO unterscheidet inzwischen nicht mehr vorwiegend zwischen dem klassischen Verlauf und dem Dengue hemorrhagic fever mit verschiedenen Schweregraden, sondern zwischen Denguefieber, Denguefieber mit Warnsymptomen (die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf darstellen) sowie schwerem Denguefieber (mit schwerem Flüssigkeitsverlust, schweren Blutungen oder schweren Organschäden).
Während eine Erstinfektion häufiger eher harmlos und grippeähnlich verläuft, kann es bei einer zweiten oder dritten Infektion vermehrt zu einem schweren hämorrhagischen Denguefieber mit einer Sterblichkeitsrate von bis zu 30 Prozent kommen, wobei besonders Kleinkinder gefährdet sind. Diese schweren Verläufe werden auf infektionsverstärkende Antikörper zurückgeführt.[5]
Diagnose: Wie stellt der Arzt Denguefieber fest?
Die typischen Symptome weisen auf die Erkrankung hin. Mit Blutuntersuchungen lässt sich die Diagnose bestätigen. Schnelltests (Enzyme-linked Immunosorbent Assay, NS1-Antigen-Nachweis) bieten ab dem ersten Tag der Infektion eine gute, einfache Diagnosemöglichkeit. Das Ergebnis bietet jedoch keine vollständige Sicherheit. Des Weiteren bilden sich im Laufe der Erkrankung Antikörper im Blut des Patienten, welche über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben können und somit auch eine stattgehabte Infektion nachweisen können. Die Antikörperdiagnostik ist im Normalfall ausreichend und eine Bestimmung des Serotyps nicht notwendig. Ab dem fünften Krankheitstag lässt sich das Denguevirus aber auch anhand seines Erbgutes innerhalb eines Tages direkt nachweisen (PCR). Mit diesem PCR-Verfahren können auch einzelne Serotypen unterschieden werden.
Im Blutbild kann die Zahl der Blutplättchen (Thrombozyten), die für eine funktionierende Blutgerinnung notwendig sind, stark abfallen.
Klinisch lässt sich der sogenannte Tourniquet-Test einsetzen, bei dem eine Blutdruckmanschette am Arm zwischen systolischen und diastolischem Blutdruckwert aufgepumpt wird und anschließend nachgesehen wird, ob sich am Unterarm kleine Einblutungen ergeben haben.
Die Diagnose muss nach dem deutschen Infektionsschutzgesetz (IfSG) an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden.
Therapie: Wie kann man Denguefieber behandeln?
Eine ursächliche Therapie steht aktuell nicht zur Verfügung. Der Arzt oder die Ärztin empfiehlt eventuell bestimmte schmerz- und fiebersenkende Medikamente. Wirkstoffe, die sich auf die Blutgerinnung auswirken – wie Acetylsalicylsäure – sollten aber strikt gemieden werden.
Verläuft die Krankheit schwerer, muss eine rasche Krankenhauseinweisung erfolgen. Dort erhalten die Patientinnen und Patienten Flüssigkeit als Infusion über die Vene, um einen Schockzustand zu verhindern. In manchen Fällen ist die Gabe von Blutkonserven oder eine intensivmedizinische Betreuung notwendig.
Vorbeugen: Wie kann man sich vor Denguefieber schützen?
Für Reisende ist zur Vorbeugung ein guter Mückenschutz wichtig. Zu beachten ist hier, dass die übertragenden Mücken auch tagaktiv sind. Grundsätzlich sollte die Kleidung die Haut möglichst weitgehend bedecken. Sinnvoll ist die Anwendung von Abwehrstoffen (Repellents). Zur Auswahl geeigneter Produkte sollten Sie sich am besten in der Arztpraxis oder Apotheke informieren. Zusätzlich kann die Kleidung mit Insektiziden imprägniert werden. Das Bett sollte man am besten mit einem Moskitonetz schützen, Insektizid-imprägnierte Netze sind von Vorteil. Auch eine Klimaanlage kann helfen, denn Mücken meiden klimatisierte Räume.
Nach aktuellen Daten scheinen seltene, schwere Verläufe bei europäischen Reisenden in ähnlicher Häufigkeit bei Erst- und Zweitinfektionen aufzutreten. Die DTG hält es daher für nicht gerechtfertigt, Reisenden von weiteren Aufenthalten in Verbreitungsgebieten abzuraten, wenn sie bereits ein Denguefieber durchgemacht haben.
Impfung
Seit März2023 ist ein Impfstoff gegen Denguefieber in Deutschland verfügbar, der für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab vier Jahren zugelassen ist. Die Impfung wird zweimal im Abstand von drei Monaten gegeben[1]. Da es sich um einen Lebendimpfstoff handelt, dürfen bestimmte Menschen nicht geimpft werden, dazu gehören Schwangere und Stillende sowie Menschen, deren Immunsystem zum Beispiel durch Krankheit oder Medikamente geschwächt ist. Eine Schwangerschaft sollte zudem mindestens in den ersten vier Wochen nach der Impfung vermieden werden.
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung allen Reisenden, die bereits eine labordiagnostisch gesicherte Denguevirus-Infektion durchgemacht und ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, zum Beispielbei Langzeitaufenthalten oder Denguefieber-Ausbrüchen im Reiseland[6]. Auch Menschen, die bereits infiziert waren und beruflich mit Dengueviren zu tun haben, etwa im Labor, sollten sich impfen lassen.
Eine allgemeine Impfempfehlung für alle Reisenden gibt die STIKO aufgrund der eingeschränkten Datenlage nicht. Sollte nach einer reisemedizinischen Beratung dennoch eine Impfung erwogen werden, so müssen Arzt oder Ärztin darüber aufklären, dass „das Risiko einer Infektionsverstärkung bei einer nachfolgenden Infektion (zum Beispiel bei der nächsten Reise) nicht ausgeschlossen werden kann“.
Wichtig: Auch wer geimpft ist, sollte auf keinen Fall auf einen Mückenschutz verzichten. Zum einen bietet die Impfung keinen hundertprozentigen Schutz, zum anderen übertragen die Mücken in den betroffenen Gebieten häufig auch andere gefährliche Krankheitserreger.

Autor und Experte: Dr. med. Markus N. Frühwein
© W&B/Privat
Unser Autor Dr. med. Markus Frühwein, hat eine eigene Praxis in München und ist Vorstand der Bayerischen Gesellschaft für Immun-, Tropenmedizin und Impfwesen e.V.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.
Quellen:
- [1] Robert Koch-Institut: Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Dengue und zur Impfung. https://www.rki.de/... (Abgerufen am 26.07.2023)
- [2] DTG: Dengue-Fieber: Aktualisierte Stellungnahme der DTG zum Risiko wiederholter Dengue-Fiebererkrankungen. https://www.dtg.org/... (Abgerufen am 17.08.2023)
- [3] European Centre for Disease Prevention and Control : Autochthonous vectorial transmission of dengue virus in mainland EU/EEA, 2010-present. https://www.ecdc.europa.eu/... (Abgerufen am 26.07.2023)
- [4] European Centre for Disease Prevention and Control: New settlements of Aedes aegypti raising concerns for continental EU. https://ecdc.europa.eu/... (Abgerufen am 03.08.2023)
- [5] Deutsches Ärzteblatt: Wenn ein Dengue-Impfstoff schwere Dengue-Erkrankungen fördert. https://www.aerzteblatt.de/... (Abgerufen am 03.08.2023)
- [6] Robert Koch-Institut: STIKO-Empfehlung zur Impfung gegen Dengue mit dem Impfstoff Qdenga. In: Epidemiologisches Bulletin 30.11.2023, 48: 3-37
- European Centre for Disease Prevention and Control : Factsheet about dengue . https://www.ecdc.europa.eu/... (Abgerufen am 03.08.2023)
- WHO: Dengue and severe dengue. https://www.who.int/... (Abgerufen am 26.07.2023)
- Rothe C, Rosenbusch D, Alberer M et al.: Reiseimpfungen – Hinweise und Empfehlungen. In: Flugmedizin Tropenmedizin Reisemedizin 01.04.2023, 30: 52-85