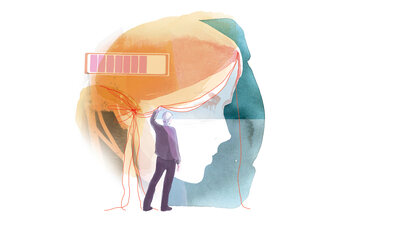Nachtschweiß: Warnsignal für Krebs?

Wer nachts schweißnass aufwacht, sollte die Ursache ärztlich klären. Nachtschweiß hat oft harmlose Gründe. Manchmal ist er ein frühes Symptom bei Krebs. Eine Therapie ist dann wichtig.
© Pixel-Shot - stock.adobe.com
Gleich vorneweg: Nachtschweiß hat häufig harmlose Gründe, zum Beispiel eine zu warme Bettdecke, Stress oder zu viel Kaffee. Bei Frauen im mittleren Lebensalter handelt es sich eventuell um Wechseljahrsbeschwerden. Auch manche Medikamente oder Übergewicht kommen als Ursache für nächtliches Schwitzen infrage. Wer nassgeschwitzt aufwacht, muss also nicht in Panik verfallen.
Aber: Hinter nächtlichen Schweißausbrüchen können auch verschiedene Krankheiten stecken – darunter bestimmte Krebs- oder Blutkrankheiten. Dann ist eine rasche Therapie wichtig. Deshalb ist es bei Nachtschweiß durchaus ratsam, der Ursache in der ärztlichen Praxis auf den Grund zu gehen.
So gilt starkes nächtliches Schwitzen als ein mögliches Symptom beim malignen Lymphom, umgangssprachlich Lymphdrüsenkrebs genannt. Das ist ein Sammelbegriff für eine Reihe eher seltener Krankheiten, bei denen sich bestimmte weiße Blutzellen unkontrolliert vermehren. Weitere Beschwerden können dazukommen. Zum Beispiel können die Lymphknoten geschwollen sein.
Auffällig ist vor allem die Kombination aus drei Symptomen:
- Nachtschweiß
- Fieber über 38 Grad Celsius
- ungewollter Gewichtsverlust: mehr als 10 Prozent in sechs Monaten
Fachleute bezeichnen diese allgemeinen Symptome als B-Symptomatik. Der Begriff stammt aus der medizinischen Einteilung für das Hodgkin-Lymphom. Die Kombination von Beschwerden kann aber auch andere Gründe haben.
Medizinerinnen und Mediziner nutzen den Begriff B-Symptomatik auch im Zusammenhang mit anderen Krankheiten – etwa bei Tuberkulose, einer HIV-Infektion oder bei anderen Tumorkrankheiten. Nachtschweiß kann zum Beispiel auch ein Zeichen für Prostatakrebs oder Nierenzellkrebs sein. Andere Blutkrankheiten sind manchmal ebenfalls mit Nachtschweiß verbunden. Mehr erfahren Sie im Ratgeber Nachtschweiß.
Wichtiger Hinweis:
Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Fragen beantworten.
Quellen:
- Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), krebsinformationsdienst.de : Fieber bei Krebs: Beschwerden und Behandlungsmöglichkeiten. https://www.krebsinformationsdienst.de/... (Abgerufen am 18.07.2023)
- Schindler E: B-Symptomatik. Pschyrembel online: https://www.pschyrembel.de/... (Abgerufen am 18.07.2023)
- Smetana G W, MD: Evaluation of the patient with night sweats or generalized hyperhidrosis. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com : https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 18.07.2023)
- Hollstein G: Nachtschweiß. Pschyrembel online: https://www.pschyrembel.de/... (Abgerufen am 18.07.2023)
- National Institute on Aging: Hot Flashes: What Can I Do? . https://www.nia.nih.gov/... (Abgerufen am 18.07.2023)
- Bryce C: Persistent Night Sweats: Diagnostic Evaluation. Am Fam Physician. 2020 Oct 1;102(7):427-433. PMID: 32996756.: https://www.aafp.org/... (Abgerufen am 18.07.2023)