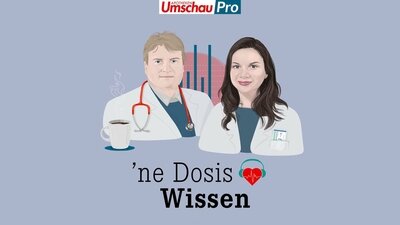Hypochondrie: Über die Angst vorm Kranksein

Immer die Angst im Kopf, ernsthaft krank zu sein: Hypochondrie ist kein harmloses Leiden.
© W&B/Patrick Paulin/Midjourney/Getty Images/E+/LukaTDB/Shutterstock/Johan Swanepoel
Eine einschläfernde Leber-Emulsion, ein kräftigendes Pulver gegen die schlechten Säfte, weiter eine abführende Arznei, um die Galle auszuscheiden. Dazu: ganze zwölf Einläufe. Als Argan in der ersten Szene des Bühnenstücks „Der eingebildete Kranke“ die monatlichen Rechnungen seines Apothekers sortiert, schmerzen ihn nicht nur wie sonst seine Eingeweide. Es sticht auch der Geiz. Denn seine Behandler lassen sich die täglichen Therapien teuer bezahlen. Doch scheint ein Ausweg gefunden: ein Arzt, der zur Familie gehört. Seine Tochter soll ihn heiraten, damit er die gefühlten Leiden des Vaters kurieren kann. Kostenlos.
Argan ist der Hypochonder par excellence. In ihm hat der französische Dichter Molière im 17. Jahrhundert einem Leiden ein literarisches Denkmal gesetzt, das die Menschheit schon viel länger begleitet als Aids-Viren und Long Covid: die krankhafte Angst vor Krankheiten.
Sorge um Gesundheit ist berechtigt
Dabei ist selbstverständlich nicht jede Sorge um die Gesundheit krankhaft. Im Gegenteil: Oft ist sie höchst gesund. Sie treibt uns zur Krebsvorsorge und mahnt uns streng, wenn wir mal wieder den Gang ins Fitnessstudio schwänzen. Doch kann die Angst vor Krankheit einem auch schier das Leben rauben. Und das nicht erst, seit „Dr. Google“ bei jedem Wehwehchen aus dem Netz flüstert: „Harmlos? Es könnte auch was Schlimmes sein!“
Von einem Leiden, das seinen Ursprung im Bereich unterhalb der Rippen hat, berichtete in der Antike bereits der griechische Arzt Galen. Er nannte es: morbus hypochondriacus. „Hypo“ bedeutet auf Altgriechisch „unterhalb“, während „chondros“ den Rippenknorpel bezeichnet. Als typische Symptome galten neben Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen und Bauchschmerzen auch Traurigkeit und Furcht, unter anderem vor Krankheiten.
Als vage Bezeichnung für eine bunte Palette an Leiden, die man heute wohl als psychosomatisch bezeichnen würde, überdauerte das Krankheitskonzept die Jahrhunderte. Bis im 18. Jahrhundert eine nie da gewesene Epidemie losbrach. Von England aus verbreitete sich ein Leiden, das man auch Spleen, Grillenkrankheit oder Milzsucht nannte. Denn die Milz galt seit jeher als Hauptproduktionsort der schwarzen Galle, welche – so der Glaube – die Körpersäfte krankhaft ins Stocken bringt. „Die Hypochondrie wurde zur Modeerkrankung“, berichtet Dr. Gaby Bleichhardt, leitende Mitarbeiterin der Psychotherapie-Ambulanz am Psychologischen Institut der Universität Marburg und Expertin für Krankheitsangst.
Besonders gefährdet sollten Gelehrte sein. „Hypochondrisch zu sein, war durchaus chic“, sagt Bleichhardt. Als Ursachen galten falsche Ernährung und ein ausschweifendes Liebesleben. Eine Empfehlung für Anfällige: nicht öfter als zwei Mal jährlich Verkehr. Als betroffen erkannte sich etwa der Philosoph Immanuel Kant, bei dem exzessive Liebesabenteuer als Ursache allerdings ausscheiden. Er führte seine Anlage zur Hypochondrie auf einen verengten Brustkorb zurück. Zudem glaubte er, eine Verbindung zwischen dem Leiden, bei dem „der Patient alle Krankheiten, von denen er in Büchern liest, an sich zu bemerken glaubt“, und der Fantasie zu erkennen. Die Hypochondrie war für ihn ein „Geschöpf der Einbildungskraft“, der Heimat also aller Dichter und Denker. Kant nannte sie daher auch „die dichtende“ Erkrankung.
Künstler und Kreative scheinen zur Krankheitsangst zu neigen
In der Tat hat es den Anschein, als würde zumindest eine Neigung zur Krankheitsangst das Dasein der Künstler und Kreativen zu allen Zeiten begleiten. Zumal eine hohe Sensibilität, verbunden mit einer übergenauen Beobachtungsgabe, durchaus das künstlerische Schaffen fördert. Allzu oft richtete sich diese auch auf den eigenen Körper. Denn der funktioniert eben selten wie eine geölte Maschine. Es erstaunt daher nicht, dass die Weltliteratur voll ist von blässlichen, krankheitsängstlichen Geschöpfen. Und um ihre Schöpfer steht es nicht besser. Teils schwer erträglich lesen sich zum Beispiel die wehleidigen Berichte, die der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann in sein Tagebuch notierte.
Auch der Dichter Franz Kafka litt an chronischen Schlafstörungen, Erschöpfungszuständen und schien auch sonst kaum ein psychosomatisches Leiden ausgelassen zu haben. Dagegen bringen einen die Notizen des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol schon mal zum Lächeln. Wenn er etwa schildert, wie er in der Diele barfüßig in ein Häufchen seines Dackels Archie tritt und daraufhin unter der Dusche eine hypochondrische Attacke erleidet. Ebenso vergnüglich: wenn der Entertainer Harald Schmidt beschreibt, wie er in einem wöchentlichen Ritual seine Lymphknoten abtastet. Eine Neigung zur Hypochondrie ist noch immer gesellschaftsfähig. Denn: Sind wir nicht alle kleine Hypochonder?
Hypochonder sind oft gefangen in der Panik
Für Psychotherapeutin Bleichhardt leiden die bekennenden Hypochonder im Showbiz vor allem medienwirksam an ihrer eingebildeten Krankheit. „Wer sich als Hypochonder inszeniert, hat die Störung in der Regel nicht“, sagt sie. Denn diese ist bitterernst.
Nur ein Ziehen in der Hüfte oder doch Knochenmetastasen eines bösartigen Tumors? Nur ein Kribbeln im Bein oder doch ein Anzeichen für eine neurologische Erkrankung? Wenn die Furcht vor Krankheiten für mehr als sechs Monate einen normalen Alltag kaum mehr möglich macht, wird sie zu einem therapiebedürftigen psychischen Leiden, das sich unter dem modernen Überbegriff „Hypochondrische Störung“ oder „Krankheitsangststörung“ in Handbüchern für medizinische Diagnosen findet.
Der ständige Drang, den gefühlten Beschwerden auf den Grund zu gehen, führt in der Regel zu zahllosen Arztbesuchen. „Die Betroffenen versuchen, sich durch die ärztliche Rückversicherung zu beruhigen“, sagt Bleichhardt. Das wirkt – allerdings meist nur kurz. Bald nagen Zweifel an der Diagnose oder es keimen neue Beschwerden auf. „Die Patientinnen und Patienten leben in einem ewigen Auf und Ab“, beschreibt es die Psychotherapeutin. Mal gelingt es, die Ängste kleinzuhalten. „Dann sind die Menschen wieder ganz gefangen in der Panik, möglicherweise bald zu sterben“, so Bleichhardt.
Eine enorme Belastung, auch für das Gesundheitssystem. Denn anders als bei Molières Paradehypochonder Argan landen die Arztrechnungen eher nicht auf dem eigenen Schreibtisch, sondern bei der Krankenkasse.
Ursachen für Hypochondrie können in der Kindheit liegen
Doch warum wird die Angst vor Krankheit bei manchen Menschen krankhaft? In einigen Fällen erzählen Betroffene von emotionaler Vernachlässigung in der Kindheit, in anderen neigten schon die Eltern dazu, den Körper und seine Befindlichkeiten allzu genau zu beobachten.
Wie bei anderen psychischen Störungen verstärken sich die Beschwerden oft, wenn weitere Belastungen im Leben dazukommen. Stirbt ein Elternteil früh an Krebs oder erleidet ein Freund beim Wandern plötzlich einen Herzinfarkt, kann das die Ängste zusätzlich triggern. Insgesamt kann Krankheitsangst aber jeden und jede treffen – Männer und Frauen erkranken etwa gleich oft. Etwa ein Mensch von 200 ist betroffen. Mildere Formen sind deutlich häufiger.
Angst machen, wie auch eine Untersuchung von Bleichhardt zeigt, vor allem Leiden, die potenziell tödlich sind. Unter den Top Drei finden sich Krebserkrankungen, Herzleiden und neurologische Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und Multiple Sklerose. Teils kommen auch ausgefallenere Erkrankungen dazu. Etwa, wenn darüber in den Medien berichtet wird. Oder man gerade im Studium darüber lernt.
Wie Studien zeigen, durchleben viele Medizinstudierende in den ersten Semestern eine akute hypochondrische Phase. In der Regel steckt hinter besonders ausgefallenen Krankheitsängsten heute aber „Dr. Google“. Denn wer hypochondrisch veranlagt ist, schlägt nicht mehr das medizinische Wörterbuch auf, sondern sucht im Netz.
Hypochondrie oder Krankheitsangst lässt sich behandeln
Möglicherweise stößt er dort allerdings auch auf eine echte Lösung seiner Probleme. Denn Krankheitsangst lässt sich behandeln. Vor allem an Kliniken gibt es therapeutische Anlaufstellen mit dem Behandlungsschwerpunkt Krankheitsangst. Wie die Ambulanz von Prof. Dr. Michael Witthöft an der Uniklinik Mainz. „Die Patientinnen und Patienten schildern oft, dass die Angst ihr Leben wie ein Grundrauschen begleitet“, berichtet er. Ständig flüstert sie ihnen zu: „Du bist ernsthaft krank, hast wohl nicht mehr lange zu leben. Und bald wird es auch medizinisch entdeckt werden.“
Die Betroffenen hören zwanghaft in sich hinein, suchen ihren Körper immer wieder nach möglichen Anzeichen ab. Ein permanenter Alarmzustand. Ein wichtiger Teil der Therapie ist es dann, sich der Krankheitsfurcht zu stellen. „Das klingt ein wenig paradox“, gibt Witthöft zu. Schließlich beschäftigen sich die Betroffenen ohnehin permanent damit. Doch bleiben die Ängste oft vage.
Im geschützten Rahmen der Therapie werden die befürchteten Katastrophen zu Ende gedacht und in Worte gefasst. Die Patientinnen und Patienten lernen, die Angst auszuhalten. Und sie erleben, dass diese schließlich von selbst wieder abnimmt. Das ist anstrengend und emotional fordernd. „Es hilft vielen aber überraschend gut“, sagt Witthöft.
Angst vor Krankheiten schlägt auf den Magen
Für die Therapierten bedeutet das nicht nur ein sorgloseres Leben, sondern auch ein gesünderes. Denn anders, als viele Betroffene sich selbst vorspiegeln, schützt die Sorge vor Erkrankungen sie nicht vor tödlichen Leiden – etwa, weil diese dadurch frühzeitig entdeckt werden. Eher ist das Gegenteil der Fall. Wie eine neue Untersuchung ergab, schlägt die Hypochondrie offenbar auf den Magen. Und nicht nur das: Wer an einer Angststörung leidet, stirbt auch eher an Herzleiden oder Atemwegsproblemen.
Eingebildete Kranke haben also durchaus auch echte Krankheiten. Was Molière seinem Publikum einst dramatisch vor Augen führte. Er übernahm in seinem berühmten Bühnenstück selbst die Hauptrolle des Hypochonders Argan. Bei der vierten Aufführung rätselten die Besucher, ob der eingebildete Kranke vielleicht doch ernsthaft leidend war. Molière brach auf der Bühne zusammen. Noch in seinem Bühnenkostüm starb er nur wenige Stunden später.
Quellen:
- Schlimpert V: Ich werde noch zum Hypochonder – wenn das Medizinstudium selbst krank macht. Online: https://archiv.unicross.uni-freiburg.de/... (Abgerufen am 05.02.2024)
- Mataix-Cols D, Isomura K, Sidorchuk A et al.: All-Cause and Cause-Specific Mortality Among Individuals With Hypochondriasis. In: JAMA Psychiatry: 13.12.2023, https://doi.org/...
-
Geyersbach U, Wieland R (2004): Die schönsten Krankheiten und die größten Hypochonder des Universums. Argon Verlag.
- Haag A: Über die Hypochondrie als Modekrankheit des 18. Jahrhunderts. Ärztliche Psychotherapie : https://elibrary.klett-cotta.de/... (Abgerufen am 05.02.2024)
-
Bleichhardt G, Weck F (2015): Kognitive Verhaltenstherapie bei Hypochondrie und Krankheitsangst. Springer Verlag.