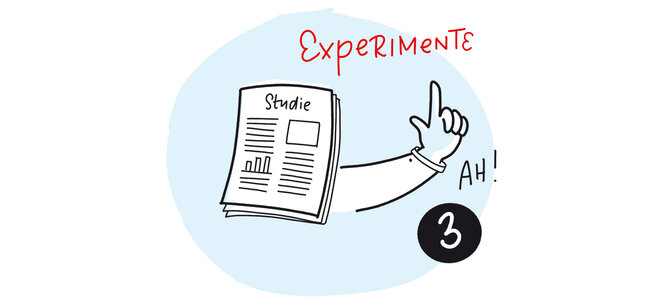Evidenzbasierte Medizin: Wissen, was wirkt

Fragiles Gebilde: Die Evidenzbasierte Medizin basiert auf drei Säulen. Stürzt eine davon ein, funktioniert das Konzept nicht mehr
© Nadine Roßa/W&B
Zuerst blutete und wucherte das Zahnfleisch. Dann fielen nach und nach die Zähne aus, Muskeln schwanden, Wunden heilten nicht mehr. Die betroffenen Seeleute halluzinierten, erblindeten und starben schließlich an der Erkrankung, die heute Skorbut heißt. Manche Schiffe verloren deshalb auf langen Reisen mehr als die halbe Besatzung. Skorbut war zwischen spätem Mittelalter und Neuzeit das fürchterlichste Schreckgespenst für Matrosen.
Die erste bekannte Vergleichsstudie
Erst der schottische Arzt James Lind legte im Jahr 1747 den Grundstein, der diesem Albtraum allmählich ein Ende bereitete. Er ging davon aus, dass die früher auch Maulfäule genannte Krankheit mit Säuren geheilt werden könne. Nur mit welcher? Lind teilte zwölf Erkrankte in sechs Gruppen ein. Je zwei erhielten dreimal täglich Essig, 25 Tropfen Schwefelsäure oder andere Delikatessen. Doch nur jene zwei Matrosen, die Orangen und Zitronen verspeisten, wurden gesund.
Es dauerte noch Jahrzehnte, bis diese Erkenntnis sich auf dem Speiseplan von Seeleuten niederschlug. Und noch viel später wurde erkannt, dass nicht die Fruchtsäuren, sondern das in den Früchten enthaltene Vitamin C Skorbut heilen und verhindern kann. Doch Lind hatte das Heilmittel mit einer Art von Experiment entdeckt, die auch heute noch als die fast optimale Form gilt, neue medizinische Erkenntnisse zu gewinnen. Er hat die erste bekannte Vergleichsstudie durchgeführt.
Die Fragen gehen nicht aus
Auch 270 Jahre nach Linds Entdeckung stellen sich in der Medizin immer wieder neue Fragen: Wirkt das neue Medikament besser gegen eine Krebserkrankung als das bisher übliche? Nimmt die Ernährung Einfluss auf den Verlauf von Rheuma? Wiegt der Nutzen eines Kathetereingriffs ins Herz die Risiken der OP auf? Welche Nach- und Vorteile bringt die lebenslange Einnahme einer Arznei gegen eine chronische Krankheit?
Je komplexer die Medizin wird und je mehr Möglichkeiten sie bietet, desto häufiger stoßen das Können und die Erfahrung von Ärztinnen und Ärzten an Grenzen. Vor allem, wenn Behandlungen nicht so eindeutig wirken wie etwa in Linds Experiment. Dann sind Forscherinnen und Forscher gefragt, die den tatsächlichen Effekt in Studien ermitteln – möglichst mit Tausenden Teilnehmenden.
So funktioniert die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Medizin – von der Studie bis zur Behandlung des Patienten:
So funktionieren heutige evidenzbasierte Studien
Die zuverlässigsten Ergebnisse liefert dabei eine verfeinerte Form jener Art von Studien, die bereits James Lind anwendete. Zum Beispiel, wenn Wirksamkeit und Risiken neuer Medikamente geprüft werden: Patientinnen und Patienten werden zwei Gruppen zugewürfelt, von denen die eine das Medikament, die andere eine Tablette ohne Wirkstoff oder die bisherige Standardarznei einnimmt.
Weder die Teilnehmenden selbst noch deren Behandlerinnen und Behandler wissen, zu welcher Gruppe der oder die Einzelne gehört. Nur so liefert eine Untersuchung ein objektives Ergebnis. Weil die Teilnehmenden zufällig auf Gruppen verteilt werden, sprechen Fachleute von randomisierten Studien (random = Englisch für Zufall).
Diese Untersuchungen sind das wichtigste Werkzeug einer Medizin, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen will. Noch besser: wenn zu einem Thema gleich mehrere davon vorliegen, die sich systematisch vergleichen und bewerten lassen. Auf diese Weise entsteht ein aussagekräftiges Bild vom Wert einer Therapiemethode.
Ein glühender Verfechter dieser so genannten Evidenzbasierten Medizin ist Professor Gerd Antes. Wie diese in die Welt kam und schließlich auch Deutschland erreichte – darüber weiß Antes alle möglichen Anekdoten zu erzählen.
Vordenker der evidenzbasierten Medizin
Zum Beispiel, dass die Wurzeln der Bewegung in Kanada liegen. Und dass ein wichtiger Meilenstein ein 1972 veröffentlichtes Buch von Archie Cochrane gewesen ist, in dem die Prinzipien der neuen Denkweise niedergeschrieben sind. Nach dem britischen Arzt ist die internationale Cochrane Collaboration benannt. Deren deutsche Vertretung, das CochraneInstitut in Freiburg, wurde seit der Gründung 1998 bis 2018 von Gerd Antes geleitet.
In Deutschland kam das Thema in den 90erJahren an. 1995 tauchte erst mals der inzwischen gängige Begriff auf, der die Orientierung der Medizin an der Wissenschaft beschreibt: Evidenzbasierte Medizin. Während „Evidence“ im Englischen Beweis bedeutet, steht das deutsche Wort „evident“ für „offensichtlich“ oder „naheliegend“. Weil die kurz EbM genannte Bezeichnung international schon länger gängig war, wurde sie hierzulande genau so übernommen.
Weitere Möglichkeiten, Wissen zu erwerben
„Es geht dabei um das beste verfügbare Wissen“, erklärt Antes. Das liefern im Idealfall randomisierte Vergleichsstudien – aber nicht nur. So kann beispielsweise auch die Nachbeobachtung von Medikamenten nach ihrer Zulassung seltene Nebenwirkungen aufdecken. Daten aus Registern können Hinweise etwa auf die Risiken bestimmter Ersatzgelenke liefern. Oder aufzeigen, wie gut Menschen mit bestimmten Erkrankungen versorgt werden.
Überall, wo es keine randomisierten Studien gibt, würde Antes schwächere Methoden ebenfalls akzeptieren – allerdings mit entsprechender Vorsicht.
Der eigene Eindruck kann täuschen
Doch ist die Orientierung an wissenschaftlichen Studien nicht zu einseitig? Für viele Patientinnen und Patienten steht etwas ganz anderes im Vordergrund: Sie wollen selbst beurteilen, wie gut eine Therapie bei ihnen anschlägt. Doch der persönliche Eindruck kann täuschen. Oft beruht die vermeintlich heilende Wirkung allein auf dem sogenannten Placeboeffekt.
Ein Beispiel: Werden Medikamente in Studien mit wirkstofffreien Scheinmedikamenten verglichen, zeigen auch Letztere meist eine gewisse Wirksamkeit. Der Glaube daran macht’s. Oder schlicht das gute Gefühl, dass sich jemand kümmert. Doch das echte Medikament könnte das behandelte Leiden womöglich viel besser lindern.
Früher schonen, heute bewegen
Wie wichtig und richtig die Orientierung an der Wissenschaft ist, zeigen manche Irrtümer der Medizin. Sie hatten sich eingeschlichen, weil Studien fehlten oder schlecht gemacht waren – bis gute Untersuchungen den Wissensstand veränderten.
So wird Frauen in den Wechseljahren heute empfohlen, Hormonpräparate allenfalls kurzzeitig und in der niedrigstmöglichen Dosis einzunehmen, weil inzwischen die Risiken gut bekannt sind. Rückenpatientinnen und -patienten erhielten lange den Rat, sich zu schonen oder ins Bett zu legen. Heute weiß man, dass Aktivität meist das Beste fürs Kreuz ist. Ähnliches gilt für Herzleiden: Angepasst an die ärztlich empfohlene Belastbarkeit profitieren Patientinnen und Patienten sogar von Sport. Menschen mit Kniearthrose wiederum nützt eine Gelenkspiegelung samt Spülung meist nicht viel: Eine vorgetäuschte OP schnitt in Studien nicht schlechter ab.
Der Placeboeffekt
Viele alternative Therapien wirken nur über den Placeboeffekt. Das vielleicht beste Beispiel dafür ist die Homöopathie. Dabei werden beliebige Ausgangsstoffe – vom Nervengift Arsen über Pflanzenextrakte bis zu Hundekot – stark verdünnt. Meist so stark, dass die Ausgangssubstanz in den Präparaten nicht mehr nachzu weisen ist. Dass solche Mittel trotz dem heilen sollen, widerspricht allem, was wir über den Körper wissen. Den noch hat die Homöopathie „eine zweite Chance bekommen“, wie der HNO Arzt Dr. Christian Lübbers es ausdrückt: In Studien hätten sie eine einwandfreie Wirksamkeit nachweisen können. Doch in allen elf bisher dazu existierenden Übersichtsarbeiten – vier davon von Homöopathen eines britischen Instituts erstellt – misslang dieser Nachweis.
Lübbers berät in seiner Praxis schon lange Patientinnen und Patienten, die noch nicht einmal vom Placeboeffekt der Homöopathika profitieren. Eines Tages entfernte er einer Vierjährigen mit fiebriger Mittelohr entzündung Globuli aus dem Gehörgang. Das war für ihn der endgültige Anlass, sich auch öffentlich für eine ehrliche Aufklärung über Homöopathie zu engagieren.
Sonderstatus für pflanzliche und anthroposophische Medikamente
Homöopathische Mittel profitieren wie anthroposophische und viele pflanzliche Medikamente von einer Sonderregel im Arzneimittelgesetz: Für sie genügt meist eine Registrierung bei der zuständigen Behörde. Auch bei Präparaten, für die eine formale Zulassung nötig ist, sind die Hürden niedrig. Das bedeutet: Ein strenger Wirksamkeitsnachweis entfällt. „Hier wird mit zweierlei Maß gemessen“, urteilt Lübbers, „das kann im Sinne der Patientensicherheit und des Verbraucherschutzes nicht länger toleriert werden.“
Zwar gebe es außer Verdünnungsfehlern bei giftigen Ausgangsstoffen keine direkte Gefahr. Indirekte aber sehr wohl: indem eine andere Behandlung verzögert oder unterlassen wird. „Die Versorgung sollte sich auf wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit stützen“, fordert Dr. Dagmar Lühmann. „Das gilt für Therapien, diagnostische Verfahren, die Bedeutung von Risikofaktoren wie für den Krankheitsverlauf.“ Lühmann ist stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, das seit 1998 für das wissenschaftsbasierte Konzept wirbt.
Die drei Säulen der Evidenzbasierten Medizin
Seither hat sich einiges getan, etwa was die Qualität von Leitlinien für Ärztinnen und Ärzte betrifft, das Medizinstudium oder die Entscheidung darüber, was Krankenkassen bezahlen müssen. Allerdings bedauert Lühmann: „Was die praktische Umsetzung in Praxen und Kliniken angeht, gibt es noch viel Luft nach oben.“
Dabei degradiert die EbM Medizinerinnen und Mediziner keineswegs. Denn sie basiert auf drei Säulen: dem bestmöglichen Wissensstand, der Ärztlichen Erfahrung und den Wünschen von Patientinnen und Patienten. Behandler können zum Beispiel von einer LeitlinienEmpfehlung abweichen, wenn sie im Einzelfall nicht passt. Sie können Behandlungsprioritäten setzen, wenn jemand an mehreren Krankheiten zugleich leidet.
Letzten Endes entscheidet ohnehin nicht die Wissenschaft über eine Therapie, sondern die Patientin oder der Patient – etwa darüber, ob man bei Gelenkverschleiß lieber mit Schmerzmitteln lebt oder einen Gelenkersatz will. Fiele eine der drei Säulen weg, würde das EbMGebäude zusammenstürzen.
Die Wissenschaft bleibt ständig im Fluss, jederzeit können neue Erkenntnisse alte Dogmen stürzen. Daher schützt Patientinnen und Patienten nichts besser vor unwirksamen und womöglich schädlichen Therapien als der aktuellste Wissensstand. Nichts gibt ihnen eine bessere Chance auf wirksame Behandlungen. James Lind würde sicher zustimmen. Dank seiner Vergleichsstudie wurde Skorbut verhindert und geheilt, das Schreckgespenst der Seeleute vertrieben.