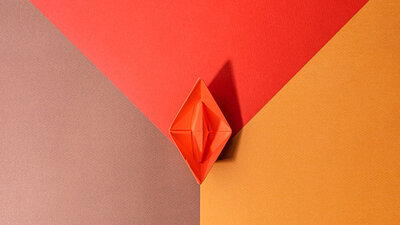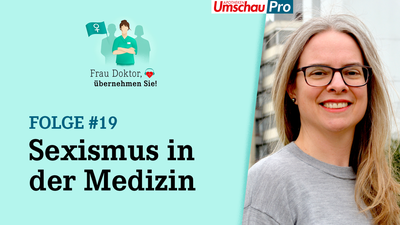Gender Pain Gap: Warum sich das Schmerzempfinden von Männern und Frauen unterscheidet

Frauen haben ein anderes Schmerzempfinden als Männer. Doch das wird im medizinischen Alltag oft verkannt.
© W&B/Silke Werzinger
Lange galt sie als Kopfschmerz, den Frauen vortäuschen, weil sie ihre Ruhe haben möchten oder keinen Sex wollen: die Migräne. „Du simulierst doch nur“, lautete die Standardantwort in vielen Beziehungen. Dabei leiden Frauen nicht nur viel stärker an Migräne als Männer, sie sind auch dreimal häufiger betroffen. Ihr Schmerz wird aber häufig abgetan – nur ein Beispiel für den sogenannten Gender Pain Gap, die Lücke zwischen den Geschlechtern beim Umgang mit Schmerz.
Frauen und Schmerzen, das scheint schon immer zusammenzugehören. Durch die monatliche Periode, Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit sind sie bei vielen Frauen ein wiederkehrender Lebensbegleiter. Körperliche Beschwerden und Schmerzen scheinen zum Frausein einfach dazuzugehören.
„Männer und Schmerzen bringen wir hingegen viel schlechter zusammen“, sagt Professorin Dr. Mandy Mangler, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtsmedizin an den Vivantes-Kliniken in Berlin. Landen Männer aber mit Schmerzen in der Notaufnahme, „werden sie schneller behandelt und bekommen stärkere Schmerzmittel verabreicht als Frauen, wie Studien zeigen.“ So wies beispielsweise eine britische Untersuchung nach, dass Patientinnen seltener Schmerzmedikamente verschrieben bekommen als Patienten.
Rollenbilder prägen die Wahrnehmung
Dass Frauen Schmerzen besser aushalten können, ist aber ein großes Missverständnis. Das Gegenteil ist der Fall: Frauen reagieren sensibler auf Schmerzen als Männer, ihr Schmerzempfinden schwankt oft auch in Abhängigkeit von ihrem Zyklus. „Es ist sehr gut und auch evidenzbasiert belegt, dass Frauen bei einigen Krankheiten wie Migräne und Fibromyalgie häufiger und auch schwerer betroffen sind. Außerdem würde niemand aus der Wissenschaft bestreiten, dass Frauen häufiger unter chronischen Schmerzen leiden“, sagt Professorin Dr. Esther Pogatzki-Zahn, die am Universitätsklinikum Münster die akute Schmerztherapie leitet.
Trotzdem wird Frauen ihr Schmerz oft abgesprochen. Sie hören, er sei psychisch oder sie würden überempfindlich reagieren. Die Gründe dafür sind vielfältig. Stereotype und eigentlich längst überholte Rollenbilder prägen noch immer unsere Wahrnehmung. Davor sind auch Ärztinnen und Ärzte nicht gefeit.
Männerdominierte Medizin
Die Medizin ist noch immer eine männerdominierte Branche. In Deutschland durften Frauen erst ab 1910 Medizin studieren. Das ist mehr als 100 Jahre her, doch es gibt noch viel Entwicklungsbedarf. „Auch wenn es mittlerweile mehr Medizinstudentinnen und Ärztinnen gibt: Die Entscheidungsträger sind weiterhin Männer“, sagt Mandy Mangler. Berlinweit ist sie eine von drei Chefärztinnen der Gynäkologie, das entspricht einer Frauenquote von 15 Prozent in der Hauptstadt.
„Das ist zu wenig, um den Blick auf eine frauenzentrierte Medizin zu lenken, wie man bei der aktuellen Gesundheitsreform sieht, bei der die Geburtshilfe nicht im Fokus steht.“ In deutschen Kliniken, so Mangler, gebe es pro Jahr rund 800.000 Geburten – an der Expertenrunde zur Krankenhausreform sei jedoch keine einzige Gynäkologin oder Hebamme beteiligt gewesen.
Ein Beispiel für die Vernachlässigung von Themen der Frauen- und Familiengesundheit, so Mandy Mangler. Und die Gynäkologin führt weiter aus: „Der Deutsche Ärztinnenbund hat in einer Erhebung nachgewiesen, dass der Großteil der Entscheidungsgremien und Kongresse von Männern besetzt sind. Sie sind es, die den Ton angeben, den Zeitgeist bestimmen – die Forschungsgelder bekommen, federführend an Leitlinien und Studien mitarbeiten. Auch in der Gynäkologie. Das ändert sich in einer Geschwindigkeit, die sehr niedrig ist. Die Medizin ist da sehr konservativ.“
Unter diesem Umstand leiden auch Transpersonen und Menschen, die sich nicht einem Geschlecht zuordnen. Mit ihnen tut sich die Medizin nach wie vor schwer. Stereotypes Denken schlägt aber in viele verschiedene Richtungen aus – zum Beispiel, wenn psychische Probleme wie Depressionen bei Männern nicht erkannt oder ernst genommen werden. Mit ein Grund, weshalb Männer sehr viel häufiger von Alkoholmissbrauch betroffen sind und die Suizidrate bei ihnen höher ist.
Endometriose: Schmerzhaft und kaum erforscht
Ein weiteres Beispiel dafür, dass Frauen in der Medizin kaum gehört werden, ist die Krankheit Endometriose. Etwa jede zehnte Frau ist betroffen, weltweit leiden 190 Millionen Menschen an ihr, in Deutschland sind es rund zwei Millionen Patientinnen. Bei dieser Erkrankung wuchert Gewebe, das dem der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist, zum Beispiel im Bauchraum. Die Folgen sind unter anderem heftige Schmerzen während der Periode, Zysten, Unfruchtbarkeit.
Bis zur richtigen Diagnose warten Betroffene im Durchschnitt zehn Jahre. Denn Ärztinnen und Ärzte nehmen die Schmerzschilderungen ihrer Patientinnen oft nicht ernst. Das seien übliche Begleiterscheinungen der Menstruation, heißt es dann. Endometriose wurde außerdem bisher zu wenig erforscht, eine Aussicht auf Heilung gibt es nicht.
Der männliche Körper als Standard
Geschlechterbilder beeinflussen nicht nur den psycho-sozialen Umgang mit Schmerz und die medizinische Behandlung, sondern auch die Forschung. Und weil in der Vergangenheit mehr Männer als Frauen in Medizin und Wissenschaft gearbeitet haben, wurde auch traditionell mehr an Männern geforscht. Oft hat das nachvollziehbare Gründe: So werden Schwangere, Kinder und alte Menschen häufig wegen Sicherheitsbedenken von Studien ausgeschlossen.
Doch wird der Mann in Medizin und Gesellschaft als Standard gesehen, leidet darunter die andere Hälfte der Menschheit. Menstruation, Geburten und schmerzhafte Erkrankungen wie Endometriose werden nicht mitgedacht. Ein Beispiel aus einem anderen Bereich: Crash Tests wurden seit jeher mit Puppen, sogenannten Dummys, durchgeführt, die einem Männerkörper nachempfunden sind.
Jahrelang wunderte man sich, warum Frauen bei vergleichbaren Verkehrsunfällen schwerere Verletzungen davontrugen, auch ihr Sterberisiko ist deutlich erhöht – man spricht hier vom Gender Safety Gap, der Sicherheitslücke zwischen den Geschlechtern. Seit 2022 gibt es den ersten Dummy mit weiblichem Körperbau, den die schwedische Forscherin Astrid Linder entwickelt hat. Im Gebrauch ist „Eva“ aber noch nicht. Aktuell schreibt die Europäische Union vor, dass Tests für Sicherheitsgurte an männlichen Crahtest-Dummys durchgeführt werden müssen.
Gleichstellung fördern
Bis heute haben Frauen zu wenig Macht, um den Blick auf eine weiblich zentrierte Medizin zu lenken. Die Veränderung geht langsam voran: Seit 2017 gibt es eine Richtlinie der Europäischen Union, die die Gleichstellung der Geschlechter in der klinischen Forschung fördern soll. Aktuell werden in der Praxis aber viel zu selten geschlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigt – und in klinischen Studien sind Frauen nach wie vor oft unterrepräsentiert.
Die Anzahl von Probandinnen in frühen klinischen Studien liegt bei zehn bis 40 Prozent. Geht es um Herz-Kreislauf-Arzneien, liegt der Frauenanteil bei einem Drittel. Um vergleichbar gültige Ergebnisse wie für Männer zu erreichen, hätte man die Mittel aber an doppelt so vielen Frauen testen müssen. Denn bei ihnen gibt es durch Wechseljahre, Zyklus sowie Verhütungsmittel große Unterschiede, wie sie Wirkstoffe aufnehmen und diese vertragen. Zudem brauchen Männer und Frauen aufgrund ihrer körperlichen Unterschiede häufig eine andere Dosierung. Auch wenn Frauen natürlich eine an ihr Gewicht angepasste Medikamentendosis bekommen, sehen sie sich dennoch dreimal so häufig mit Nebenwirkungen konfrontiert wie Männer.
Dass eine männerfokussierte Medizin für Frauen sogar lebensgefährlich sein kann, zeigt sich am Beispiel des Herzinfarkts. 27.000 Männer und 18.000 Frauen sterben jährlich an ihm. Erleidet eine Frau einen Infarkt, dauert es eine Stunde länger, bis sie in die Notaufnahme kommt. Ein Grund dafür: andere Symptome. Während Männer in der Regel einen Druck in der Brust verspüren, der bis in den Arm ausstrahlt, haben Frauen häufiger untypische Anzeichen wie Übelkeit, Blässe, Schweißausbrüche oder Atemnot. Mehr Informationen und Daten zu Beschwerden bei Männern als bei Frauen: Das nennt man Gender Data Gap. Eine weitere Lücke.
Diskrimminierung auch bei der Hautfarbe
Je stärker der zu behandelnde Mensch also vom Standard – hierzulande: weiß und männlich – abweicht, desto mehr ist er im Nachteil. Studien belegen, dass schwarze Patientinnen und Patienten im Krankenhaus erst später und dann auch schwächere Schmerzmittel verabreicht bekommen. „Sie müssen mehr Schmerzen aushalten, weil das rassistische Stereotyp, dass schwarze Menschen schmerzresistenter sind, bis heute greift, das zeigen Studien aus den USA. Schwarze Frauen werden doppelt diskriminiert, man spricht ihnen, meist unbewusst, wegen ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts, also aufgrund von rassistischen und sexistischen Vorurteilen, den Schmerz ab“, sagt Dihia Wegmann, Bildungsreferentin von der Fachstelle Gender und Diversität NRW (FUMA) in Essen.
Die gute Nachricht: Langsam wird die Schmerzlücke kleiner, zum Beispiel bei Migräne: Die neue Leitlinie, erschienen im Oktober vergangenen Jahres, berücksichtigt, dass Frauen dreimal häufiger betroffen sind als Männer. Eine Studie der Berliner Charité hat herausgefunden, dass der Entzündungsbotenstoff CGRP, der bei Migräne freigesetzt wird, während der Regelblutung besonders hoch ist. Denn Frauen simulieren nicht: Ihr Schmerz ist echt.
Mehr zum Gender Pain Gap hören Sie in unserem Podcast „The Sex Gap“
Quellen:
- Samulowitz, A et al: "Brave Men" and "Emotional Women": A Theory-Guided Literature Review on Gender Bias in Health Care and Gendered Norms towards Patients with Chronic Pain . In: Online: 25.02.2018, https://doi.org/...
- Schäfer et al: Health care providers' judgments in chronic pain: the influence of gender and trustworthiness . Online: https://doi.org/... (Abgerufen am 28.04.2023)
- Linder, Astrid: Road safety: the average male as a norm in vehicle occupant crash safety assessment. In: Online: 26.03.2020, https://doi.org/...
- Europa-Parlament: Promoting gender equality in mental health and clinical research. Online: https://www.europarl.europa.eu/... (Abgerufen am 28.04.2023)
- Ghoshal, M et al: Chronic Noncancer Pain Management and Systemic Racism: Time to Move Toward Equal Care Standards. Online: https://www.tandfonline.com/... (Abgerufen am 28.04.2023)
- Kennedy-Moulton et al: MATERNAL AND INFANT HEALTH INEQUALITY: NEW EVIDENCE FROM LINKED ADMINISTRATIVE DATA. Online: https://www.nber.org/... (Abgerufen am 28.04.2023)
- Mechsner, S: Früherkennungsprogramm an der Charité: Endometriose endlich ernst nehmen. Online: https://www.aerzteblatt.de/... (Abgerufen am 28.04.2023)
- Raffaelli, B et al: Sex Hormones and Calcitonin Gene–Related Peptide in Women With Migraine. In: Online: 22.02.2023, https://doi.org/...
- Deutsche Gesellschaft für Neurologie: Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne. Online: https://register.awmf.org/... (Abgerufen am 09.12.2022)
- RKI: Migräne und Spannungskopfschmerz in Deutschland. Prävalenz und Erkrankungsschwere im Rahmen der Krankheitslast-Studie BURDEN 2020. Online: https://www.rki.de/... (Abgerufen am 02.05.2023)