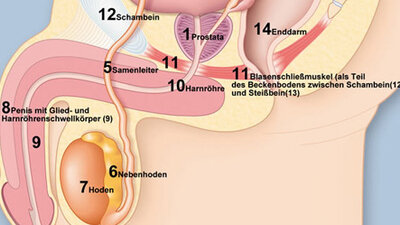Die Krankheitsfahnder

© W&B/Lêmrich
Sechs Jahre lang war Marleen Schmitt für die Medizin ein rätselhafter Fall. Es begann schon am Tag ihrer Geburt. Sie konnte beim Stillen die Milch nicht schlucken, schuld war eine Fehlbildung der Speiseröhre. Im Kindergarten fiel auf, dass sie schwerhörig war. Das kleine Mädchen kämpfte außerdem immer wieder mit fiebrigen Infekten und extrem starkem Nasenbluten.
Ratlosigkeit in Arztpraxen und Kinderkliniken. Auffällige Blutwerte warfen nur neue Fragen auf, statt Ant- worten zu liefern. Hat das Kind Leukämie? Eine Umweltvergiftung vielleicht? Nichts davon bestätigte sich. „Meine Diagnose habe ich nur einem glücklichen Zufall zu verdanken“, erzählt die Hotelfachwirtin.
Ein Arzt, der sie an der Kinderklinik in Würzburg untersucht hatte, arbeitete danach ein Jahr lang in den USA und begegnete dort zum ersten Mal in seinem Berufsleben einem Patienten mit Fanconi-Anämie. Die Symptome waren denen von Marleen Schmitt frappierend ähnlich. Genetische Tests brachten endlich Klarheit: Auch sie trägt Erbanlagen für das extrem seltene Leiden, an dem nur etwa fünf von einer Million Kindern erkranken.
Fanconi-Anämie: eine sehr seltene Krankheit
Etwa 300 Betroffene gibt es schätzungsweise in Deutschland. Die allermeisten Ärztinnen und Ärzte kennen die Fanconi-Anämie also höchstens aus dem Lehrbuch – wenn überhaupt. Es ist ein Problem, das alle seltenen Erkrankungen verbindet und ihre Diagnose enorm erschwert.
Per Definition gilt eine Erkrankung in Deutschland dann als selten, wenn es nicht mehr als fünf Fälle unter 10 000 Menschen gibt. „Man schätzt jedoch, dass 6000 bis 8000 seltene Krankheiten existieren. Damit dürften etwa vier Millionen Menschen hierzulande betroffen sein“, sagt Professor Dr. Jürgen Schäfer. Der Internist leitet das Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Marburg und erlebt dort jeden Tag, was es für Menschen heißt, als „ungeklärter Fall“ mit immer dickerer Patientenakte durchs Gesundheitswesen zu geistern.
Die Schar der Verzweifelten, die vergeblich versuchen, den Grund für ihre Beschwerden herauszufinden, ist groß. Viele Symptome, mit denen sich seltene Krankheiten zeigen, sind unspezifisch. Unklare Muskelschmerzen, ständige Müdigkeit, kleine Auffälligkeiten im Blutbild – da können zahlreiche Ursachen dahinterstecken. Nur logisch und auch sinnvoll, dass beim Arztbesuch erst einmal gängige Diagnosen abgeklärt werden.
Experte Schäfer schildert, was dann passiert: „Die Hausärztin findet nichts, also schickt sie den Patienten zum Facharzt. Findet auch dieser keine Erklärung für die Symptome, überweist er an den nächsten Kollegen.“ So beginne für die Leidgeplagten eine manchmal jahrelange Odyssee. Die Krankenakte wird immer dicker und unübersichtlicher. Irgendwann fragen sich schließlich viele Patientinnen und Patienten: „Bilde ich mir alles vielleicht nur ein?“ Dabei kann manchmalschon ein einziger Blutwert auf die richtige Spur führen.
Diagnose seltener Erkrankungen
„Kürzlich konnten wir für einen Patienten mit Hypophosphatasie eine Diagnose stellen“, erzählt Schäfer. Dieser seltenen Erkrankung liegt ein genetisch bedingter Defekt des Enzyms alkalische Phosphatase zugrunde. Deren Konzentration im Blut ist ein häufig gemessener Laborwert. Aber Ärztinnen und Ärzte achten in der Regel nur darauf, ob er erhöht ist – was zum Beispiel ein Hinweis auf Leber- oder Kno- chenerkrankungen sein kann.
„Stark erniedrigte Werte, wie sie für die Hypophosphatasie typisch sind, werden leicht übersehen. Manche Labore geben den unteren Normwert auch gar nicht an“, so Schäfer. „Unsere Kollegin fand den entscheidenden Hinweis in mühseliger Kleinarbeit in der mehrere Hundert Seiten dicken Krankenakte.“ Für den Patienten, den seine Ärzte schon als eingebildeten Kranken abgestempelt hatten, bedeutete die Diagnose eine unglaubliche Erleichterung.
Um die Versorgung der Hilfesuchenden zu verbessern, entstand 2010 am Universitätsklinikum Tübingen das erste deutsche Zentrum für Seltene Erkrankungen. Weitere Einrichtungen folgten, viele erst in jüngerer Zeit. Insgesamt 33 sind es inzwischen. Eines davon ist das Centrum für Seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER) an der Universitätskinderklinik Bochum, geleitet von Dr. Corinna Grasemann.
Wenn die auf Hormon- und Knochenerkrankungen spezialisierte Kin- derärztin ihren Alltag beschreibt, wird schnell klar: Hier läuft vieles anders als im regulären Medizinbetrieb. Den Kern der Abteilung bildet ein festes Team, das jeden Fall gemeinsam bearbeitet. Es umfasst Fachärztinnen und Fachärzte unterschiedlicher Disziplinen, eine Psychologin, eine Gesundheitswissenschaftlerin und einen Experten für Patientenregister. Anfragen kommen von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, von Kliniken oder auch direkt von Patientinnen und Patienten, die glauben, an einer unerkannten Krankheit zu leiden.
Schuhkartons voller Patientenakten
„Gerade wenn sich Patienten in Eigeninitiative an uns wenden, müssen wir oft noch ärztliche Unterlagen nachfordern“, berichtet Grasemann. Sie rät deshalb, Hausärztin oder Hausarzt lieber von Anfang an mit an Bord zu holen. Ist alles komplett, arbeiten sich Medizinstudierende akribisch durch die Aktenberge und stellen relevante Daten übersichtlich zusammen. Das dauert. „Es sind ja oft lange Krankengeschichten“, so die Expertin. „Manchmal bekommen wir mehrere Aktenordner oder gar Schuhkartons voll mit Vorbefunden.“
Ist die Vorarbeit geschafft, folgen Teambesprechungen. Diese sogenannten Fallkonferenzen, in denen alle ihr Wissen und ihre Erfahrung zusammenbringen, sind charakteristisch für die Arbeit der Zentren. „Bei Bedarf ziehen wir externe Expertinnen und Experten hinzu oder laden die Patienten zu uns in die Sprechstunde ein“, erzählt Grasemann. Blutproben gehen zur Diagnostik ans hauseigene Kliniklabor oder an Speziallabore.
Mitunter kommt das CeSER-Team so Infektionen durch ungewöhnliche Viren oder Bakterien, seltenen Krebsformen oder Autoimmunstörungen auf die Spur. Vier von fünf seltenen Erkrankungen haben allerdings einen genetischen Ursprung. Im Fall des zehnjährigen Philippe vernetzte sich das Bochumer Zentrum mit Spezialisten in Bonn – und konnte den Eltern einige Wochen später endlich sagen, was ihr Kind hat. Ein einziges verändertes Gen verursacht bei Philippe das Glass-Syndrom.
Nur 22 Betroffene gibt es hierzulande, ein US-Mediziner aus Arkansas ist weltweit der einzige Experte für das extrem seltene Leiden. „Als unser Sohn ein Jahr alt war, wurde allmählich sichtbar, dass er sich nicht so entwickelt wie andere Kinder“, erinnert sich die Mutter. Je älter das Kind wurde, umso mehr Symptome zeigten sich: Philippe lernte erst mit vier Jahren zu laufen, sprach nicht, hatte ständig Verdauungsprobleme. Dann begannen sich allmählich seine Oberschenkelknochen zu verformen.
So hilft die Diagnose - auch wenn es keine Heilung gibt
„Neun Jahre lang reisten wir zu Kinderärzten und Kliniken in ganz Deutschland, um den Grund für all das herauszufinden“, erzählt die Mutter. Die Eltern stießen manchmal auf Empathie, manchmal auf Unverständnis. „Mein Eindruck war oft, wir Eltern sollten doch bitte einfach akzeptieren, dass unser Kind behindert ist.“ Jetzt, wo sie die Diagnose kennen, können Philippes Eltern endlich nach vorn blicken.
Es gibt keine Heilung, aber neue Optionen. „Wir sind mit anderen betroffenen Eltern in Deutschland und im Ausland in Kontakt, geben uns gegenseitig Ratschläge; das hilft enorm.“ Eine Website mit Infos zur Erkrankung sei bereits erstellt, eine europaweite Selbsthilfeorganisation gegründet. Indem sie sich künftig noch enger vernetzen, moderne Gendiagnostik nutzen und auf digitale Technologien setzen, wollen die Zentren für seltene Erkrankungen den Weg zur Diagnose erleichtern und verkürzen.
So sollen künftig etwa Computeralgorithmen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, den Teams die langwierige Vorarbeit abnehmen, indem sie die Patientenakten gezielt nach Symptomen und Laborwerten durchsuchen. In Bayern setzt man auf computergestützte Kooperation. Sechs Zentren haben sich hier im BASE-Netz zusammengeschlossen. Eines davon ist das Zentrum für Seltene Erkrankungen Nordbayern in Würzburg, geleitet von Professor Helge Hebestreit, einem Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin.
Moderne Konzepte sollen helfen
Das BASE-Konzept erspare oft monatelanges Sammeln von Unterlagen, Papierberge und weite Wege, erklärt er. „Patientinnen und Patienten können uns gemeinsam mit ihren Behandlern Befunde elektronisch übermitteln, diese sind dann für alle im Team des Zentrums einsehbar.“ Beratungsgespräche fänden persönlich oder auch virtuell statt. Das System schicke regelmäßig Benachrichtigungen zum aktuellen Stand der Dinge. „So wissen immer alle, wo wir gerade stehen.“
Ein anderes innovatives Projekt, an dem sich elf deutsche Zentren beteiligen, setzt bei den psychischen Aspekten der seltenen Leiden an. Dabei sitzen von Anfang an auch auf Psychiatrie oder Psychosomatik spezialisierte Kolleginnen und Kollegen im Team. Sie sollen helfen, herauszufinden, ob eine angegriffene Psyche Folge oder Ursache der Erkrankung ist. Viele der von seltenen Krankheiten Betroffenen haben zusätzlich zu körperlichen Symptomen psychische Probleme.
Kein Wunder, findet Dr. Beate Kolb Niemann, Oberärztin der Klinik für Psychosomatik am Universitätsklini kum Marburg: „Viele dieser Menschen müssen lange Zeit mit Schmerzen und anderen Beschwerden leben, ohne dass ein Grund dafür gefunden wird. Sie fühlen sich von Ärzten und ihrem sozialen Umfeld nicht ernst genommen.“
Nur die Psyche?
Man unterstelle ihnen, zu dramatisieren oder sich alles nur einzubilden. Depressive Verstimmungen, Ängste, Stress und sozialer Rückzug seien häufig die Folge, berichtet Kolb Niemann. Die ärztliche Vermutung „Das könnte auch psychisch sein“ ist deshalb bei Menschen mit seltenen Erkrankungen oft nicht einmal falsch, und psychologische Unterstützung kann für die Patientinnen und Patienten sehr hilfreich sein.
„Leider wird aber häufig ohne vorherige Abklärung, ob das seelische Leiden die körperlichen Beschwerden tatsächlich verursacht haben kann, eine Psychotherapie empfohlen, nur weil man körperlich nichts findet“, erklärt Expertin Kolb Niemann. Genau das musste Ursula Metze erleben. Als ihre Krankheit ausbrach, stand sie mitten im Leben: 50 Jahre alt und als Leiterin einer heilpädagogischen Einrichtung beruflich voll im Einsatz.
Dann fingen die Muskelkrämpfe in den Beinen an. „Ich wurde unsicher beim Gehen, bin oft gestürzt“, erinnert sie sich. Die vorher so selbstsichere Frau entwickelte Ängste auf offenen Plätzen oder Stra ßen, dazu eine unerklärliche Schreckhaftigkeit. Irgendwann blieb nur noch die Wohnung als Rückzugsort. Ihren Beruf musste sie aufgeben. War sie angespannt, etwa bei Arztterminen, versteifte ihre Muskulatur. „Da saß ich dann und die Neurologen bekamen die Symptome quasi live vorgeführt“, sagt sie. Eine Diagnose fand sich nicht.
Es folgten: Psychotherapien und Aufent halte in psychosomatischen Kliniken, insgesamt viereinhalb Jahre lang. Als einer der Psychotherapeuten Eheprobleme hinter den Beschwerden vermutete, hatte Ursula Metze genug. „Zum Glück habe ich einen wunderbaren Hausarzt“, erzählt sie. Der glaubte nicht an eine psychische Erkrankung und schickte seine Patientin erneut in eine Fachklinik. Dort wurde schließlich das seltene Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert.
Eine Mixtur aus körperlichen und psychischen Symptomen ist typisch für diese neurologische Erkrankung. „Das Syndrom ist nicht heilbar und ich bin pflegebedürftig, aber Medikamente helfen mir“, sagt die Rentnerin. Auch ihre glückliche Ehe gibt ihr Halt. Vor vier Jahren hat sie mit ihrem Mann goldene Hochzeit gefeiert.