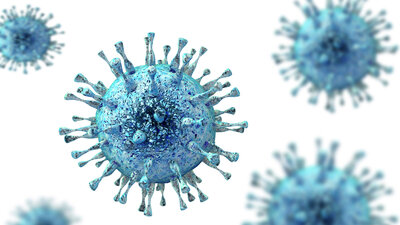"Mit jedem Tag fällt mir die Decke mehr auf den Kopf"

Wochenlang niemanden treffen – gerade Alleinstehenden droht die Einsamkeit
© Stockbyte/ RYF
Seit der Covid-19-Pandemie teilt sich mein Leben in ein Davor und ein Danach. Wie für viele, ich weiß. Wo andere aber weiter wenigstens ein reduziertes Sozialeben haben, habe ich jetzt nur noch Telefonkontakt.
Nicht, dass ich dauernd jemanden um mich bräuchte, im Gegenteil. Ganz bewusst hatte ich mir bis vor zweieinhalb Wochen diesen einen Tag in der Woche eingerichtet, den ich mir freigehalten habe: Keine Verabredungen, nichts an Programm. Nur Zeit für mich und mein liebstes Hobby, das Lesen. Allein sein ist nicht einsam sein, hatte ich mir oft gesagt, seit mein Mann gestorben war.
Tatsächlich bin ich unter normalen Umständen wohl das, was man eine rüstige Rentnerin nennt. Dreimal die Woche treffe ich mich mit einer Freundin. Je nach Wetter gehen wir zusammen ins Hallenbad oder zum Laufen um den nahen See. Ein fixer Termin sind außerdem die Treffen mit einem lieben Ehepaar und zwei weiteren Alleinstehenden: Zusammen haben wir vor Jahren eine nette Gruppe ins Leben gerufen. Meist kochen wir zusammen, wenn wir uns sehen, mal hier, mal da. Später dann: Backgammon oder Skat, Geselligkeit.
"Wann wir uns wohl wiedersehen?"
Karin rundet das Potpourri meiner gesellschaftlichen Kontakte ab. Meine Alltagsfreundin nenne ich sie manchmal. Ingrid wiederum nennt mich ihre "Stütze". Die Mittfünfzigerin hat eine psychische Erkrankung, ist erwerbsunfähig und froh, wenn sie durch die ein oder andere Unternehmung mit mir, "Struktur" bekommt. Zuletzt, vor zweieinhalb Wochen, hat sie mir beim Renovieren meiner Küche geholfen. Hat mir angehalten, für mich ausgemessen und am Abend mit mir bei einem Gläschen Wein das Ergebnis gefeiert.
Ich weiß noch genau, wie ich zum Abschied gemeint habe: Wann wir uns wohl wiedersehen? Jeder wusste, dass die Regierung gerade dabei war, über Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 nachzudenken. Vom Kopf her wusste man das. Wie dieses Ding Namens soziale Isolation sich anfühlen würde? Wohl kaum einer hat sich das vorstellen können.
Wir hier in Bayern waren ja mit die ersten, die die Ausgangssperre hatten. Schon in den Tagen davor war ich vorsichtig gewesen. Als Rentnerin muss ich ja nicht zwingend unter Leute, habe ich mir gesagt. Und dass es eine vorübergehende Vorsichtsmaßnahme ist, jetzt vermehrt zu Hause zu bleiben. Angelo, ein junger Mann, dem ich Nachhilfe gebe, war schließlich der letzte, der meine Wohnung betreten hat. Seitdem er gegangen ist, ist es still geworden.
Wer stützt hier eigentlich wen?
Die ersten Tage hatte wenigstens noch der Baumarkt geöffnet. So wie andere gerne shoppen gehen, liebe ich es, hier zu stöbern und mir neue Projekte für die Wohnung auszudenken. Plötzlich kam man nur noch mit Gewerbeschein hinein. Als ich das gehört habe, ist mir der Ernst der Lage zum ersten Mal so richtig klar geworden. Jetzt bist du allein, habe ich gedacht. Und ich habe an Karin gedacht und dass da gerade etwas im Begriff war, sich zu drehen.
Wer stützt hier eigentlich wen? frage ich mich jetzt, wenn wir miteinander telefonieren. Einmal täglich tun wir das. "Lass uns das bitte beibehalten", höre ich mich noch sagen, wenigstens dieser eine Fixpunkt. Die Tage gehen langsam neuerdings, die Zeit zerrinnt. Oft tue ich Dinge, die für mich bis vor Kurzem ein No-Go waren: Bis halb zehn im Bett liegen bleiben etwa. Erst gegen Mittag frühstücken. Seichte Filme gucken. Heile Welt, wenn schon nicht da draußen, dann wenigstens hier.
Ein Zustand wie ausgeliefert
Mein Mann würde die Hände überm Kopf zusammenschlagen, könnte er mich so sehen. Unlängst hat sich sein Todestag zum fünften Mal gejährt. Eine harte Zeit war das damals, als er nach langer schwerer Krankheit starb. Kurz darauf musste ich innerhalb weniger Monate meine Eltern beerdigen – drei Todesfälle in vier Monaten! Am absoluten Tiefpunkt wähnte ich mich. Aber verglichen mit dem Tief, in dem ich jetzt stecke, gab es einen Unterschied. Du kannst wieder Land sehen, wenn du dich bemühst – diese Erfahrung machte ich damals. Es war Arbeit, mit der Zeit wieder unter Leute zu gehen, sich zu treffen. Aber immerhin: Es gab diese Möglichkeit. Jetzt dagegen fühle ich mich wie ausgeliefert. Kann nichts gegen diesen Zustand tun, wie er ist.
Skypen – wie ein kleiner Besuch?
Oder vielleicht doch? Gestern, als ich mit Karin telefonierte, bin ich hellhörig geworden. Du klingst gut sagte ich. Wenn du mich nur sehen könntest, meinte sie. Mir sind dann meine Eltern eingefallen, die damals drei Autostunden entfernt gelebt haben. Und zu denen ich wegen der zunehmenden Pflegebedürftigkeit meines Mannes immer seltener hingefahren bin.
Also habe ich uns Skype installiert. Das ist wie ein kleiner Besuch, sagte mein Vater, wenn wir dann einander vom Bildschirm aus anschauten. Tatsächlich: Vieles, was davor im Verborgenen geblieben war, konnte ich jetzt sehen. Saßen sie nebeneinander oder getrennt? Lächelte Mama? Oder hatte sie wieder diesen verkrampften Zug um den Mund? Hatten die beiden vielleicht wieder ihre stille Woche?
Menschen sind Augenwesen. Mit Freunde beobachte ich, wie unter anderem die EU Politiker neuerdings virtuell in Kontakt sind. "Das können wir auch", habe ich gestern zu Karin gesagt. Morgen nun wollen wir einen ersten Versuch starten. Karin ist skeptisch. Fürchtet Office-Atmosphäre. Aber vielleicht lässt sich das Ganze ja auflockern? Rechner raus aus dem Büro und auf den Esstisch? Tasse Kaffee daneben? Stückchen Kuchen dazu? Ja, ein virtueller Kaffeeklatsch schwebt mir vor.
Die menschliche Nähe fehlt
Es tut gut, sich Strategien zu überlegen. Aber die Begrenztheit der Möglichkeiten zu sehen tut gleichzeitig weh. Meine Freundschaften gehen sonst alle sehr herzlich. Wir umarmen uns viel. Ich bekomme Sehnsucht, wenn ich daran denke. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass mir meine Lieben einmal so fehlen würden. Und dass nichts, wirklich gar nichts zu helfen scheint gegen den Blues.
Während der ersten Zeit zum Beispiel hatte ich ständig den Fernseher oder das Radio laufen, vorgetäuschte Gesellschaft. Aber die hat leider ihre Tücken: Alle 30 Minuten Nachrichten mit Zahlen von Infizierten und Toten, das schafft einen. Auch wenn ich leise drehe, nicht wirklich hinhöre: Unbewusst nimmt man das weiter auf.
Das Einzige, was helfen würde: Sich aufraffen und rausgehen
Natürlich, wir alle wissen das: Das Leben endet mit dem Tod, keiner kennt den Tag und die Stunde. Jetzt aber, im Ausnahmezustand, werden solche Kalendersprüche auf einmal konkret. Muss ich mich wirklich schon verabschieden?, habe ich mich gerade gestern gefragt. Gar nicht mal unbedingt ans Sterben dachte ich dabei. Eher an all das, was mal mein Lebenskonzept ausgemacht hat. Oft sitze ich jetzt einfach nur da und grüble. Wir haben eine gefährdete Mitbewohnerin, hörte ich die Frau aus der Wohnung unter mir neulich zu einer Nachbarin sagen. Und dass die ganze Familie deshalb vorsichtig sei und Abstand halte.
Endzeitstimmung löst sowas aus. Und ich weiß: Das einzige, was dagegen helfen könnte, wäre mich aufzuraffen und wie gestern ein Stück mit dem Rad zu fahren. Zum Milchhäuschen etwa, um ein bisschen einzukaufen. Aber ich schaffe es einfach nicht. Bin nicht der Typ, der mal eben an die frische Luft geht, mag sowas in Gesellschaft tun.
Und vielleicht habe ich ja auch Angst: Nicht schon wieder einer Familie begegnen. Ja, mir ist bewusst, was diese Leute derzeit stemmen. Schule, Haushalt, Homeoffice – keine Ahnung, wie man das schaffen kann. Aber wenigstens haben die sich, denke ich dann weiter. Und das ist wichtiger als alles andere sonst.