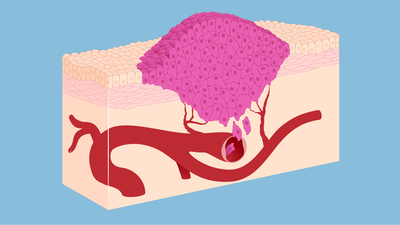Schlimme Diagnose für Angehörige: Wie reagieren?
Eine schlimme Krankheit stellt die Welt auf den Kopf. Auch für Partner, Familie, Freunde und Kollegen ist eine solche Nachricht ein Einschnitt. Die Reaktionen sind unterschiedlich und oft von Unsicherheit geprägt. Dr. Susanne Weg-Remers leitet den Krebsinformationsdienst am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und kennt das Problem aus ihrer täglichen Arbeit.

Dr. Susanne Weg-Remers ist Ärztin und berät Krebspatienten am Telefon („Krebsinformationsdienst“)
© W & B/ Michael Hudler
Frau Dr. Weg-Remers, wie reagiere ich richtig, wenn mir jemand von einer schrecklichen Diagnose erzählt?
Viele sind im ersten Moment sprachlos. Das kann man auch so zugeben – statt aus der Hilflosigkeit heraus etwas Unüberlegtes zu erwidern. Eine schlimme Diagnose stellt das gesamte Umfeld unter hohen Stress und Druck. Alle brauchen Zeit, um sich zu sortieren.
Wie muss ich mir die aktuelle Gefühlslage meines Gegenübers vorstellen?
Der Betroffene ist im Schockzustand und steckt im Gefühlschaos. Mal dominiert die Hilflosigkeit, mal die Traurigkeit. Dazu kommen Angst, Wut, Scham. Besonders nahe Bezugspersonen erleben dieses Hoch und Runter der Emotionen mit und können teils schwer damit umgehen.
Viele bemühen sich dann besonders stark um den Erkrankten. Wenn man ständig um ihn herumwirbelt, kann das die Belastung aber noch verschärfen. Oder überschütten ihn mit Ratschlägen. Dabei darf man nicht vergessen: Kurz nach einer schlimmen Diagnose erleben die Patienten extremsten Kontrollverlust. Wenn man dann ständig hört, was einem jetzt doch guttun würde, kann das noch mehr verwirren.
Was ist dann die bessere Reaktion?
Das hängt auch von der aktuellen Erkrankungssituation ab und dem Alltag mit seinen Behandlungen. Manchmal hilft es Betroffenen, wenn man sie einfach auch mal in Ruhe lässt, wenn sie sich zurückziehen. Doch generell sollte man immer wieder versuchen, im Gespräch zu bleiben. Und nicht einfach über den Kopf des Betroffenen hinweg handeln, sondern lieber fragen: „Was täte dir jetzt gut?“
Hilft Optimismus?
Du musst nur positiv denken, dann wirst du gesund – diese Aufforderung setzt kranke Menschen extrem unter Druck. Denn nicht jeder ist kampfesmutig in der Zeit nach einer schweren Diagnose. Und es beinhaltet die Botschaft, dass man nicht genug gekämpft habe, wenn man nicht gesund wird. Auch vermeintlich mutmachende Parolen wie „Du packst das schon!“ oder „Das wird schon!“ sind nicht immer zielführend. Viele Patienten fühlen sich dann mit ihren Sorgen und Schmerzen nicht ernst genommen.
Nicht jeder steht dem Erkrankten nah. Als Nachbar oder Kollege greift man schon mal zu solchen Plattitüden. Oft wird auch aus Hilflosigkeit oder falscher Rücksicht das Gespräch eher ganz gemieden. Das ist für Betroffene sehr belastend, wenn sich das Umfeld distanziert oder sich gar nicht mehr meldet. Auch als Arbeitskollege kann man den Patienten immer ansprechen.
Aber wie?
Einstiegssätze könnten zum Beispiel sein: „ Ich habe gehört, was passiert ist. Wie wäre es dir am liebsten, wie wir damit umgehen?“ Dann kann der Patient frei entscheiden, mit wem er wie über seine Krankheit reden will. Wenn er signalisiert, dass er nicht über das Thema sprechen will, sollte man das respektieren. Und wenn derjenige aggressiv reagiert, dann darf man Grenzen setzen: „Ich kann dich verstehen, kann aber ja nichts dafür. Was können wir tun?“
Reagieren Männer und Frauen eigentlich unterschiedlich auf eine schlimme Diagnose?
Frauen suchen in einer Krankheitssituation mehr nach sozialer Unterstützung, während sich Männer eher zurückziehen und weniger über das reden, was sie belastet. Dieser Rückzug kann als Selbstschutz notwendig sein.
Wie geht man als Freund oder Angehöriger damit um?
Man kann nur vorsichtig Gesprächsangebote machen. Kommen zum Rückzug eine stark gedrückte Stimmung und Schlafstörungen dazu, kann sich eventuell eine Depression entwickeln. Dann sollte man versuchen, den Betroffenen davon zu überzeugen, sich ärztliche Hilfe zu holen. Angehörige fühlen sich ohnmächtig, wenn ihre Hilfsangebote ständig abgelehnt werden.
Generell dürfte so eine Situation für das unmittelbare Umfeld belastend sein, oder?
Auf jeden Fall. Angehörige übernehmen dann zwei verschiedene Rollen. Sie sind auf der einen Seite helfende Unterstützer, auf der anderen sind sie in hohem Maße selbst betroffen. Wir wissen aus Studien, dass Angehörige oder Partner psychisch ähnlich belastet sein können wie der Erkrankte selbst.
Wie wirkt sich das auf das Zusammenleben, den Alltag aus?
Je mehr sie den Alltag teilen, umso einschneidender verändert die Diagnose das gemeinsame Leben. Immer mehr steht die Krankheit im Mittelpunkt. Die Patienten können womöglich ihre Rolle in der Familie nicht mehr übernehmen und sind zusehends auf Hilfe angewiesen. Es gibt eine Vielzahl von praktischen und organisatorischen Fragen, besonders wenn Kinder mit betroffen sind – zum Beispiel wenn der Vater auf einmal allein dasteht. Etliche Angehörige leiden auch unter Existenzängsten.
Wie gehen Angehörige Ihrer Erfahrung nach damit um?
Viele neigen dazu, die eigenen Bedürfnisse zu missachten. Doch sie brauchen Erholung, gerade wenn es um eine nicht heilbare Erkrankung geht. Kleine Auszeiten können helfen, die inneren Batterien aufzuladen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, sich mit anderen betroffenen Angehörigen auszutauschen und in der Betreuung abzuwechseln.
Wo gibt es Unterstützung?
Man kann sich an den Kliniksozialdienst oder die Psychoonkologen in der Krebsklinik wenden, in der der Erkrankte behandelt wird. Am besten in Absprache mit dem Krebskranken. Falls das keine Option ist, finden Angehörige Hilfe in ambulanten Krebsberatungsstellen, die von unterschiedlichen Trägern unterstützt werden, von den Landeskrebsgesellschaften, der Caritas oder den Gesundheitsämtern. Meist sind die Angebote kostenfrei oder nur mit geringer Selbstbeteiligung.
Besonders groß dürfte die Herausforderung für Paare sein, oder?
Viele Betroffene reagieren distanziert, wollen etwa nicht angefasst werden. Oder haben Angst, nicht mehr attraktiv zu wirken. Das ist für den gesunden Partner schwer einzuordnen. Nimmt er zu sehr Rücksicht und zieht sich ebenfalls zurück, führt das womöglich in einen Teufelskreis.
Wie kann man als Paar damit umgehen?
Offenheit lässt sich nicht erzwingen. Aber man kann immer wieder respektvoll fragen. Zum Beispiel: „Ich würde dich gern in den Arm nehmen, darf ich das?“ Auch spezielle Paarberatungen helfen, wenn die Liebe leidet. Manchmal hilft es schon, sich bewusst für eine kleine Auszeit von der Erkrankung zu verabreden. Das kann ein Ritual sein, etwa jeden Abend gemeinsam einen Tee zu trinken oder spazieren zu gehen. Sich dabei ins Gedächtnis rufen, was einem immer schon Spaß gemacht hat – und was man trotz der Erkrankung gemeinsam machen kann.