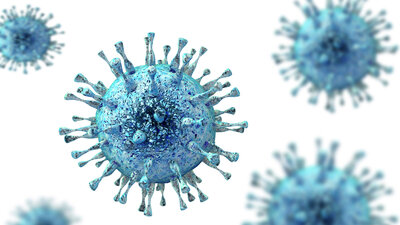Die wichtigsten Fakten zur Impfung gegen Covid-19
Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist für die Menschheit vergleichsweise neu. Ende 2019 wurden erste Fälle beim Menschen entdeckt, in den Monaten danach entwickelte sich eine weltweite Pandemie. Inzwischen gibt es Impfstoffe gegen Covid-19, wie die durch das Virus ausgelöste Erkrankung heißt. Die Pandemie ist mittlerweile in eine endemische Phase übergegangen. Schwere Krankheitsverläufe kommen derzeit seltener vor als zu Beginn der Pandemie - einerseits durch die vorherrschenden Omikron-Virusvarianten, andererseits durch die stärkere Immunität der Menschen durch Impfungen und Infektionen. Das Virus ist jedoch weiterhin vorhanden. Ein Überblick zu Impfung und Impfstoffen.
Was ist die aktuelle Impfempfehlung der Stiko?
Eine Impfung gegen Covid-19 empfiehlt die Stiko (Ständige Impfkommission)
- für alle Menschen ab 18 Jahren
- für alle Personen ab sechs Monaten mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf durch eine Grundkrankheit
- für alle Menschen mit einem aus beruflichen Gründen erhöhten Risiko, an Covid-19 zu erkranken
- für Familienmitglieder und enge Kontaktpersonen von Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben und selbst nicht durch eine Impfung ausreichend geschützt werden können
Ziel ist es, eine Basisimmunität gegen SARS-CoV-2 aufzubauen. Sie wird normalerweise erreicht durch eine Grundimmunisierung (in der Regel zwei Impfungen im Mindestabstand von drei bis vier Wochen, je nach Impfstoff) plus eine Auffrischimpfung nach einem Mindestabstand von sechs Monaten. Auf diese Weise erhält das Immunsystem mindestens dreimal Kontakt zu Bestandteilen des Erregers. Eine durchgemachte Coronavirus-Infektion kann einen dieser drei Kontakte eventuell ersetzen. Wie in so einem Fall geimpft werden sollte, besprechen Betroffene am besten individuell mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt.
Für wen empfiehlt die Stiko weitere Auffrischimpfungen?
Zusätzlich zum Erreichen einer Basisimmunität (siehe oben) empfiehlt die Stiko eine Auffrischung der Impfung für
- alle Menschen ab 60 Jahren
- alle Menschen ab sechs Monaten mit erhöhtem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf durch eine Grundkrankheit
- Menschen, die aus beruflichen Gründen ein erhöhtes Risiko haben, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren, etwa in medizinischen Berufen
- Familienmitglieder und enge Kontaktpersonen von Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben und selbst nicht durch eine Impfung ausreichend geschützt werden können
- Bewohner und Bewohnerinnen in Pflegeeinrichtungen
Die Auffrischimpfung sollte in der Regel jährlich stattfinden - bevorzugt im Herbst, beziehungsweise mindestens 12 Monate nach der letzten SARS-CoV-2-Infektion oder -Impfung. Bei besonders gefährdeten Menschen kann eine Auffrischimpfung eventuell in kürzeren Abständen sinnvoll sein. Die Ärztin oder der Arzt beraten dazu. In der Regel sollte für die Auffrischimpfung ein mRNA-Impfstoff verwendet werden - bevorzugt ein an die vorherrschenden Virusvarianten angepasster Impfstoff, der für die jeweilige Altersgruppe zugelassen beziehungsweise empfohlen ist.
Bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis unter fünf Jahren ist noch kein Impfstoff zur Auffrischimpfung zugelassen. Zur Auffrischimpfung kann eventuell ein altersgerecht dosierter Impfstoff „off-label“ angewandt werden. Ärztin oder Arzt beraten dazu.
Impfstoffe gegen SARS-CoV-2
- BioNTech/Pfizer „Comirnaty“
Am 21.12.2020 wurde von der Europäischen Kommision für den ersten Impfstoff eine bedingte Zulassung erteilt. Es ist der mRNA-Impfstoff BNT162b2 von BioNTech/Pfizer, der in Deutschland entwickelt wurde. In der EU wird er unter dem Namen "Comirnaty" vermarktet.
Für eine vollständige Immunisierung sind zwei Impfdosen nötig. Die Stiko (Ständige Impfkommision) empfiehlt einen Impfabstand von drei bis sechs Wochen. Ein vollständiger Impfschutz im Sinne einer Grundimmunisierung besteht ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung.
- Moderna „Spikevax“
Anfang Januar 2021 erfolgte eine weitere bedingte Zulassung eines Impfstoffes in der EU. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen mRNA-Impfstoff. Dieser wurde vom US-Unternehmen Moderna entwickelt. Initial unter dem Namen „Covid-19 Vaccine Moderna“ vermarktet, wurde er im Juni 2021 in „Spikevax“ umbenannt.
Für eine vollständige Immunisierung sind zwei Impfdosen nötig. Die Stiko empfiehlt einen Impfabstand von vier bis sechs Wochen. Ein Impfschutz im Sinne einer Grundimmunsierung besteht ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung.
Hinweis: Menschen unter 30 Jahre und Schwangere sollen laut der Stiko nicht mit dem Impfstoff von Moderna, sondern nur noch mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer und geimpft werden. Der Grund: Nach der Moderna-Impfung (Spikevax) treten in dieser Altersgruppe Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen wohl häufiger auf als nach der BioNTech-Impfung.
- Janssen-Cilag International/Johnson & Johnson “JCOVDEN“
Im März 2021 erhielt auch ein vierter Impfstoff die Zulassung von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA: das Präparat des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson/Janssen-Cilag. Hierbei handelt es sich um einen Vektor-Impfstoff.
Bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson war eigentlich standardmäßig nur eine einmalige Impfung vorgesehen. Menschen mit diesem Impfstoff hatten jedoch am häufigsten einen Impfdurchbruch (eine Covid-19 Erkrankung trotz vollständigem Impfschema). Deshalb empfiehlt die Stiko inzwischen eine zweite Impfung mit einem mRNA- oder einem Nuvaxovid-Impfstoff ab vier Wochen nach der Erstimpfung mit Johnson & Johnson.
Hinweis: Bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson gilt die Empfehlung, den Impfstoff erst ab 60 Jahren anzuwenden, da es bei diesem Vektor-Impfstoff sehr selten zum Auftreten von Thrombosen und begleitendem Blutplättchenmangel (Thrombopenie) kam.
- Novavax „Nuvaxovid“
Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax ist seit Dezember 2021 ebenfalls in der EU zugelassen. Die Stiko empfiehlt ihn für Menschen ab 12 Jahren zur Grundimmunisierung. Dafür sind zwei Impfungen im Abstand von mindestens drei Wochen notwendig. Die Anwendung in der Schwangerschaft oder Stillzeit ist aufgrund der geringen Datenlage zu dem Impfstoff und dem darin enthaltenen Wirkverstärker derzeit nicht empfohlen.
- Valneva „Covid-19 Impfstoff Valneva“
Es handelt sich um einen Ganzvirusimpfstoff, der für Personen zwischen 18 und 50 Jahren zugelassen ist. Zur Grundimmunisierung sind zwei Impfungen notwendig, die im Abstand von mindestens vier Wochen erfolgen sollten. Die Anwendung in der Schwangerschaft oder Stillzeit ist aufgrund der geringen Datenlage zu dem Impfstoff derzeit nicht empfohlen.
- AstraZeneca „Vaxzevria“
Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca erhielt Ende Januar 2021 die Zulassung. Er war damit der dritte in der EU zugelassene Impfstoff gegen COVID-19. Initial war er unter dem Namen „Covid-19 Vaccine AstraZeneca“ verfügbar, seit März 2021 erfolgte eine Umbenennung in „Vaxzevria“. Es handelt sich um einen Vektor-Impfstoff. Er kommt in Deutschland inzwischen nicht mehr zum Einsatz.
Für eine vollständige Immunisierung sind zwei Impfdosen nötig. Die Stiko empfahl den Impfstoff zuletzt aber nur noch für Menschen über 60 Jahre. Außerdem sollte nur eine Impfung mit Vaxzevria und die zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen (heterologes Impfschema). Ein vollständiger Impfschutz im Sinne einer Grundimmunisierung besteht dann ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung.
Antworten auf häufige Fragen zum Thema "COVID-19 und Impfen" gibt es auf den Seiten des Robert Koch-Instituts:
COVID-19 und Impfen: Antworten auf häufig gestellte Fragen
Wie wirksam sind die Impfstoffe?
Die Impfung bietet im allgemeinen einen guten Schutz vor einer schweren Erkrankung. Vor einer Ansteckung mit dem Virus kann sie hingegen nicht immer schützen.
Seit Beginn der Pandemie kommt es außerdem immer wieder zum Auftreten von Virusvarianten. Diese Varianten unterscheiden sich bezüglich des ursprünglichen Wildtyps durch bestimmte Erregereigenschaften, wie beispielsweise durch eine höhere Übertragbarkeit oder auch der Erreger-Empfindlichkeit gegenüber der Immunantwort des Menschen (Suzeptibilität). Gerade solche Virusvarianten werden vom Robert Koch-Institut als besorgniserregende Virusvarianten (variants of concern, VOC) eingestuft. Bei neuen Virusvarianten müssen Fachleute prüfen, ob der entsprechende Impfstoff noch ausreichend wirksam ist oder Anpassungen sinnvoll sind.
Welche Nebenwirkungen sind derzeit bekannt?
- Impfreaktion
Bekommt man eine Impfung, setzt sich das Immunsystem danach mit dem Impfstoff auseinander. Es kann zu sogenannten Impfreaktionen kommen. Die Impfstoffe können nach derzeitigen Erkenntnissen unter anderem zu Schmerzen an der Einstichstelle, zu Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen, Fieber und Schüttelfrost führen. Diese Beschwerden sollten nach wenigen Tagen wieder verschwinden.
Laut Europäischer Arzneimittelbehörde EMA besteht die „Möglichkeit“, dass die Corona-Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna ursächlich mit heftigen Menstruations-Blutungen zusammenhängen: Laut Studien dauerte die Menstruation bei manchen Frauen nach einer Impfung länger oder war intensiver. Die beobachteten Beschwerden sind laut EMA zumeist vorübergehend und nicht schwerwiegend. Es gebe auch keinerlei Hinweise, dass sie negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit hätten.
Impfkomplikation
Unter Impfkomplikationen versteht man Ereignisse, die die übliche Impfreaktion übersteigen und mit teils schweren Folgen für die Betroffenen verbunden sind. Bei den Vektor-Impfstoffen gegen Covid-19 kam es zum Beispiel in sehr seltenen Fällen zum Auftreten von Blutgerinnseln (Thrombosen) - unter anderem der Hirnvenen (Sinusvenenthrombose) oder im Bauchraum - und einer Verringerung der Blutplättchenzahl (Thrombopenie) mit erhöhter Blutungsneigung kommen. Vereinzelt kam es auch zu allergischen Sofortreaktionen (Anaphylaxie).
Bei den mRNA-Impfstoffen kam es in sehr seltenen Fällen zu Überempfindlichkeitsreaktionen, welche sich in einer Schwellung des Gesichts und einem Quaddelbildung der Haut (Nesselsucht) äußerten. Vereinzelt kam es auch zu allergischen Sofortreaktionen (Anaphylaxie). Auch eine Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung kann eine sehr seltene Nebenwirkung der mRNA-Impfung sein, die vor allem junge Männer nach der zweiten Impfung betrifft.
Auch bei Novavax wurde in wenigen Fällen über Herzmuskel- und -beutelentzündungen berichtet, ebenso wie sehr selten über allergische Reaktionen. Zu Valneva liegen bisher nur wenige Daten vor.
Das Paul-Ehrlich-Institut erfasst und bewertet kontinuierlich die gemeldeten Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gegen Covid-19. Hier kommen Sie zu den Sicherheitsberichten:
Paul-Ehrlich-Institut: Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen
Wichtiger Hinweis:
Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Fragen beantworten.