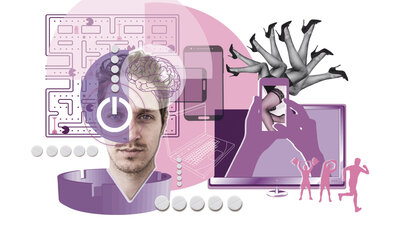Interview: Hilfen für Kinder aus suchtbelasteten Familien
Fast jedes sechste Kind in Deutschland kommt aus einem Haushalt mit einer Suchtproblematik. Darauf weist die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) hin. Wir sprachen mit Regina Müller, DHS-Referentin für Selbsthilfe und Nachsorge.

Regina Müller ist Referentin für Selbsthilfe und Nachsorge bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V.
© DHS
Frau Müller, gut drei Millionen Kinder und Jugendliche kommen aus einem Haushalt mit Suchtproblematik. Das sind ja erschreckende Zahlen. Wie kann diesen Kindern geholfen werden?
Wichtig ist zunächst, dass es in der Gesellschaft überhaupt erst mal so etwas wie ein Bewusstsein für das Problem gibt. Die genannten Zahlen sind da übrigens auch nur ein Anhaltspunkt. Tatsächlich gehen wir von einer sehr hohen Dunkelziffer aus.
Von den rund drei Millionen Kindern und Jugendlichen, die in einer Suchtfamilie aufwachsen, sollen etwa 2,65 Millionen Eltern mit einer Alkoholproblematik haben. Wenn Sie von einem fehlenden gesellschaftlichen Problembewusstsein sprechen: Meinen Sie damit die Gefahr durch Alkohol?
Ja! Alkohol ist die Droge Nummer eins in unserem Kulturkreis und gesellschaftlich breit akzeptiert. Der Umgang mit dem Thema ist extrem doppeldeutig. Alkohol wird von großen Teilen der Bevölkerung konsumiert, bei Festen beispielsweise gehört das Trinken meistens einfach dazu. Gleichzeitig wird erwartet, dass Menschen mit Alkohol so umgehen, dass der Konsum nicht zu einem Problem wird. Ein Widerspruch, der dazu verleitet, Missstände herunterzuspielen beziehungsweise sie gar nicht erst wahrzunehmen.
Sollten Außenstehende also sensibler sein und auch eher mal reagieren, wenn sie mitbekommen, dass in einer Familie etwas nicht stimmt?
Ich würde da differenzieren. Generell ist Aktionismus der falsche Weg. Wenn aus dem Bauch raus beziehungsweise reflexartig reagiert wird, muss das nicht unbedingt hilfreich sein.
Wozu raten Sie stattdessen?
Auch wenn das vielleicht verwunderlich klingt: Man sollte zunächst bei sich selbst ansetzen und sich fragen: Was genau nehme ich wahr? Und was befürchte ich? Warum sehe ich darin ein Problem? Grundlegend muss man verstehen, dass Alkoholabhängigkeit eine Erkrankung ist.
Wissen das viele denn nicht?
Leider ist das noch immer nicht überall durchgedrungen und selbst für die, die es wissen, scheint es oftmals eher Theorie, weil das Trinken von Alkohol gesellschaftlich als normal gilt. Unser Umgang mit Betroffenen und ihren Angehörigen, auch den Kindern, ist ein anderer, wenn klar ist: Wir reden hier über eine Krankheit. Wer wenig über diese Krankheit weiß, kann sich informieren.
Wie und wo?
Zum Beispiel über die kostenfreien Informationsmaterialien der DHS. Wir haben Broschüren zum Thema Kinder aus Suchtfamilien herausgegeben, die Anregungen geben, wie man unterstützen kann. Förderlich ist, die Ressourcen des Kindes zu stärken oder Brücken zu Hilfeangeboten zu bauen. Hier denke ich zum Beispiel an die Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien, NACOA, die unter anderem gute Tipps gibt, wie man mit betroffenen Kindern altersgemäß über Alkohol sprechen kann. Zudem gibt es DHS Infomaterialien, die sich an die betroffenen Kinder richten.
Und dann? „Ich habe den Eindruck, du oder auch: dein Partner könnte alkoholkrank sein…“ – könnte das ein Einstieg in ein Gespräch sein?
Wenn ich verstanden habe, dass wir hier über eine Erkrankung sprechen, kann ich mich im nächsten Schritt vom Gedanken verabschieden, dass das Problem schnell innerhalb der Kernfamilie gelöst werden kann. Eine schwere Erkrankung lässt sich nicht kurzerhand wegzaubern. Diese Erkenntnis muss aber nicht zu Untätigkeit führen. Es gibt Möglichkeiten. Ansätze. Man kann verstehen: Es gibt Dinge, die brauchen alle Kinder, egal ob sie in einer intakten oder in einer suchtbelasteten Familie aufwachsen.
Nur in einem stabilen Umfeld können Kinder sich gut entwickeln. Aber genau diese Stabilität scheint in Suchtfamilien oftmals zu fehlen. Worauf wollen Sie hinaus?
Darauf, dass Kinder ihre Eltern lieben und loyal mit ihnen sein wollen – auch dann, wenn diese von außen betrachtet nicht so funktionieren, wie sie sollten. Kinder haben nur diese einen Eltern. Natürlich wird es so sein, dass ein Kind sich wünscht, dass die Mama oder der Papa sich anders verhalten. Aber Wünschen und Aussprechen sind zwei paar Stiefel. „Das ist nicht gut, dass deine Mama so viel trinkt…“, - wenn ich um die Gefühle des Kindes weiß, sollte ich mich mit solchen Äußerungen zurückhalten. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass Kinder das sehr wohl mitbekommen, wenn sie sich nicht auf ihre Eltern verlassen können, wenn zu Hause Streit ist oder auch, wenn der Partner des betroffenen Elternteils durch den Alkoholkonsum sehr belastet ist. Botschaften wie: „Diese Familie ist nicht gut für dich“ oder – schlimmer noch – „es wäre besser, du könntest woanders aufwachsen“, sind aber ein No-Go. Das gleiche gilt für an die Eltern gerichtete Bemerkungen wie „Bei euch läuft was schief“. Damit übertrete ich eine rote Linie.
Jetzt haben wir viel über das gesprochen, was man nicht tun sollte, wenn man in Kontakt mit einer suchtbelasteten Familie ist. Was sollte oder kann man tun?
Zu allererst: Sich ehrlich bewusst machen: Möchte und kann ich wirklich helfen? Bin ich bereit, dafür Zeit zu investieren? Die Hilfe, die Kinder aus suchtbelasteten Familien benötigen, gelingt nur über Beziehung. Und Beziehung ist etwas anderes als ein auf Kurzfristigkeit angelegter Kontakt. Sagen wir so: Die Nachbarin oder auch den Lehrer würde ich hier spontan ermutigen, hier ist der Kontakt in der Regel ja langfristig. Die Tante, die am anderen Ende von Deutschland lebt, würde ich hingegen eher bremsen.
Und dann bleibt das Kind mit seinem Problem alleine?
Nein, vielleicht kennt die Tante ja jemanden, der andere Möglichkeiten hat. Etwa die Oma, die in der Nähe der Familie wohnt und die einen guten Draht zum Kind hat. „Du bist wichtig als Ansprechpartnerin für das Kind, du könntest helfen“, könnte die Tante der Oma mitgeben – so etwas in der Art ist sehr hilfreich als Motivation. „In der Familie geht es drunter und drüber, vielleicht kannst du mal nach dem Rechten schauen?“: So bitte nicht! Suchtbelastete Familien zu unterstützen erfordert Fingerspitzengefühl. Aber keine Sorge: Niemand ist hier auf sich gestellt, es gibt wie gesagt guten professionellen Support. Ganz generell ist eines besonders wichtig: Das Kind muss wissen, dass es nicht schuld ist.
Denken Kinder das denn? Dass sie schuld sind, wenn ein Elternteil trinkt?
Leider ja! Kinder verstehen die Hintergründe der Erkrankung nicht. Die schwierige Situation für die Kinder kann sehr schnell Mitleid bei potenziellen Helferinnen und Helfern auslösen. Trotzdem gilt es erst mal zu verstehen, was ein Kind mit suchtkranken oder psychisch kranken Eltern braucht. „Armes Kind, schlimme Eltern …“, solche Botschaften sind das Gegenteil von Unterstützung. Nochmal: Kinder lieben ihre Eltern. Und: Sie wollen „gute“ Kinder sein.
Was hilft den betroffenen Kindern noch?
Wenn sie durch mich etwas erleben können, was zu Hause vermutlich selten ist: Eine unbeschwerte, entspannte Zeit und kindgerechte Aktivitäten ohne Stress. Aus der Resilienz-Forschung weiß man, dass es verschiedene Faktoren gibt, die Kinder stark machen können – auch außerhalb des Elternhauses. Als Großvater, Onkel oder Lehrerin kann ich ein solcher stark machender Faktor sein. Wie gesagt: Schon allein dadurch, dass das Kind über mich ein anderes Beziehungsverhalten mitbekommt. Wenn dann in einem zweiten Schritt über das aufgebaute Vertrauen gute Gespräche entstehen, umso besser.
Wenn die Sucht tatsächlich im Gespräch mit dem Kind Thema wird: Was gilt es zu beachten?
Nehmen wir mal an, das Kind sagt: „Warum hört der Papa denn einfach nicht mit dem Trinken auf? Er hat es doch versprochen.“ – „Ja, das hat er“, kann ich dann sagen. Aber der Papa ist krank und mit dieser Krankheit schaffen es Menschen manchmal nicht, auch wenn sie es noch so sehr wollen.“ Das Kind versteht dann: Mein Papa hat mich nicht angelogen. Das ist eine wichtige Botschaft. Sowas kann über Außenstehende übrigens manchmal leichter transportiert werden als über die Partner der Betroffenen, denen aufgrund der eigenen starken Belastungen der Blick über den Tellerrand und leider auch auf die Bedürfnisse der Kinder schwerfällt.
Apropos: Wie verhalte ich mich den Eltern gegenüber? Bisher haben wir nur über den Beziehungsaufbau zum Kind gesprochen.
Suchterkrankungen sind stark schambehaftet. Daher sollte jede Art von Druck tabu sein. Das Tempo geben stets die Betroffenen selbst vor, niemand sonst. Dennoch sollte ich mich nicht scheuen, in einer passenden Situation meine Sorge zum Ausdruck zu bringen und mögliche Probleme anzusprechen. Am besten über „Ich-Botschaften“ wie „Ich mache mir Sorgen“. Um dann, ohne Vorwürfe, schildern, welche Beobachtungen ich gemacht habe. Wenn mein Gegenüber sich daraufhin öffnet, kann ich natürlich sagen, was ich weiß. Zum Beispiel, dass Alkoholsucht eine Erkrankung ist, die heilbar ist. Dass der oder die Betroffene nicht allein ist, dass es vielfältige Hilfen gibt. Das setzt aber echtes Interesse voraus. Das mag banal klingen, ist aber wesentlich für einen möglichen Austausch. Ich kann das nur immer wieder betonen: Wenn ich wirklich helfen will, darf ich nicht den Richter spielen. Helfen heißt: In Kontakt gehen, da sein, Angebote machen.
Aber ist das nicht ein bisschen zu beliebig? Sie sagen ja selber: In suchtbelasteten Familien bleiben Sachen liegen, die Kinder erleben wenig Verlässlichkeit. Was, wenn das Ganze in Richtung Verwahrlosung geht? Man kann ein Kind aus einer solchen Familie nach einem netten Nachmittag im Zoo doch nicht einfach wieder daheim abliefern, als sei dort alles in Ordnung?
Eines sollte natürlich ganz klar sein: Wenn das Kindeswohl gefährdet scheint, muss unverzüglich gehandelt werden. Ansprechpartner ist dann das Jugendamt. Ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, sollte von einer professionellen Ansprechperson der Jugendhilfe beurteilt werden.