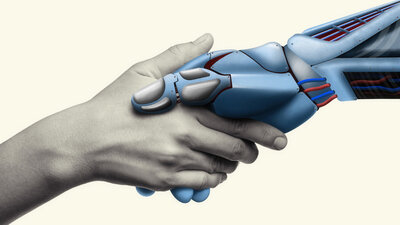Künstliche Intelligenz: Doktor KI – übernehmen Sie?

Künstliche Intelligenz kann Ärztinnen und Ärzten in vielerlei Hinsicht von Hilfe sein - nicht nur in Form von ChatGPT.
© Patrick Paulin
Der Leiter des Instituts „AI for Health“ (Künstliche Intelligenz für die Gesundheit), Dr. Carsten Marr, sitzt am Rechner in seinem Büro bei Helmholtz Munich. Auf seinem Bildschirm: Bilder von Blutausstrichen und Programmiercodes. Sie sind Grundlage für ein KI-Modell, das Blutkrebs besser und schneller erkennen soll als der Mensch. Das Ziel: die arbeits- und zeitintensive mikroskopische Untersuchung von Blut- und Knochenmarkzellen durch KI zu erleichtern. Bei Verdacht auf Blutkrebs begutachten Fachkräfte Hunderte Zellen eines Blutausstrichs unter dem Mikroskop und kategorisieren diese. Das dauert Stunden. Schafft die KI es bald in Sekunden? Derzeit werden die Hochleistungsrechner bei Helmholtz mit über 200 000 Bildern von Zellen von über 1000 Patientinnen und Patienten mit verschiedenen Bluterkrankungen gefüttert.
Wo kommt KI in der Medizin bisher zum Einsatz?
Aber was ist denn nun eigentlich KI, also Künstliche Intelligenz? Das KI-System ChatGPT selbst sagt: „Künstliche Intelligenz bezeichnet den Bereich der Informatik, der sich mit der Entwicklung von Maschinen befasst, die Aufgaben erledigen können, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern.“ Klingt schlüssig. Auf die Medizin übertragen bedeutet es, dass die KI anhand großer, medizinisch geprüfter Datensätze künstliches Wissen erzeugt. Beispielsweise sind das beschriftete Bilder von roten und weißen Blutkörperchen mit der Information über den jeweiligen Zelltyp. Die Software lernt dann selbst, optimal zwischen den Zelltypen zu unterscheiden. „Ziel ist, dass die KI in einem komplett neuen Bild erkennt, ob es sich um ein rotes oder weißes Blutkörperchen, eine gut- oder bösartige Zelle handelt“, so Experte Marr.
Computer sollen durch diese Art des Lernens das Gleiche tun, was unser Gehirn automatisch macht, nämlich Dinge erkennen. Wie man sie dazu bringt? Etwa mithilfe von Bildern und Codes. Diese nutzen die Programmierer, um den Rechnern beizubringen, was sie erkennen sollen. Anhand von Schritt-für-Schritt-Anleitungen, sogenannten Algorithmen, lernen die Systeme dann selbst, Muster zu erkennen, ohne dass ihnen jemand sagt, worauf sie achten sollen. Diese Muster helfen der KI schließlich zu sehen, was ein Bild zeigt. Wiederholt man dieses Lernen des Algorithmus mithilfe von riesigen Datenmengen, werden die Muster für Computer deutlicher und sie erkennen die Bilder immer besser.
KI: Wie ist der aktuelle Stand?
Wie hilfreich künstliche Intelligenz schon jetzt in der Praxis ist, weiß der Radiologe Prof. Mike Notohamiprodjo. Er ist geschäftsführender Gesellschafter eines radiologischen Praxisverbundes in der Metropolregion München. Das Arztnetz arbeitet schon seit Jahren mit Entwicklungsabteilungen von Technologiefirmen zusammen und probiert neue Lösungen im Bereich KI aus, um geeignete Systeme dauerhaft in den Praxisalltag zu integrieren.

Verschiedene Anwendungsbereiche, in denen Künstliche Intelligenz in der Praxis unterstützen kann.
© W&B/Astrid Zacharias
„Was die KI mittlerweile sehr gut kann, ist, einfache Ja-Nein-Fragen zu beantworten“, so der Fachmann. Zum Beispiel, ob ein Patient einen Tumor hat oder eine Patientin einen Knochenbruch – oder eben nicht. In diesen Fällen kommt die KI mittlerweile auf ähnliche Sensitivitäten wie ein Radiologe oder eine Radiologin, was bedeutet: Auch die Software übersieht nur wenige erkrankte Personen. „Der Radiologe und die KI zusammen sind ein gutes Team – besser als die KI allein und auch besser als der Arzt allein“, sagt Notohamiprodjo.
Welche Vorteile bietet KI?
Die Vorteile einer KI seien auch ganz praktische. „Sie wird nicht müde, hat keinen Hunger“, so der Mediziner. „Und sie ist häufig besser als unerfahrene Ärzte oder Ärztinnen, weil sie auf das erlernte Wissen aus großen Datensätzen zurückgreift.“ Blind vertrauen sollte man der KI jedoch nicht: „Wir stehen noch ganz am Anfang und haben einen langen Entwicklungsprozess vor uns“, sagt Notohamiprodjo. Er zieht einen gut nachvollziehbaren Vergleich: die Entwicklung von Einparkhilfen in Autos. „Am Anfang hatten wir nur Piepser, die gewarnt haben, wenn wir zu nah an ein Hindernis gefahren sind. Dann folgten die Rückfahrkameras. Mittlerweile können Autos auf Knopfdruck automatisch einparken.“ Trotzdem bleibe die Verantwortung beim Fahrer, der jederzeit ins Lenkrad greifen oder auf die Bremse treten kann.
Genauso sei es in der Medizin. „Durch die KI werden wir schneller und besser – doch die Kontrolle und Verantwortung liegen beim Arzt oder der Ärztin.“ Die KI kommt zum Beispiel derzeit noch an ihre Grenzen, wenn verschiedene Diagnosen möglich sind, etwa bei einer Person mit Knieschmerzen. Hier gibt es zahlreiche mögliche Ursachen: Meniskus, Bänder und so weiter. Damit ist KI – noch – überfordert.
Wie hilft KI in der Therapie?
Doch nicht nur in der Diagnostik kann künstliche Intelligenz hilfreich sein, sondern auch in der Therapie, zum Beispiel von Typ-1-Diabetes. Erkrankte müssen sich regelmäßig Insulin spritzen, um ihren Blutzuckerspiegel zu senken. Die richtige Dosis zu finden kann jedoch herausfordernd sein. Das weiß der Leipziger Start-up-Gründer Thomas Wuttke aus eigener Erfahrung, er ist selbst betroffen. Früher spritzte er nach bestem Wissen und Gefühl. Die Insulindosis war dadurch oftmals nicht passgenau. Kohlenhydrate aus Essen und Trinken und körperliche Aktivität beeinflussen den Blutzucker. Ebenso Müdigkeit, Tageszeit, Krankheit, Stress und Zeitverschiebung. Das macht die Diabetes-Therapie nicht einfach. Die Folge falscher Dosierungen sind Über– oder Unterzuckerungen, die langfristig gesundheitsschädlich sein können.
Mit digitaler Technologie solche Therapiefehler zu vermeiden war Wuttkes Ziel, als er und sein Team eine schlaue App fürs Smartphone entwickelten. Sie zeigt dank KI laufend die gerade nötige Insulindosis an. Zusätzlich zur App braucht man noch einen kontinuierlich messenden Glukosesensor am Körper und einen handelsüblichen Pen zum Spritzen des kurzwirksamen Insulins.
Die App erfasst drahtlos die Blutzuckerwerte aus dem Sensor. Die Kohlenhydrate jeder Mahlzeit müssen manuell eingegeben werden. Die KI beobachtet den Stoffwechsel des Anwenders. Dadurch lernt sie die Ernährungs- und Verhaltensweisen täglich besser kennen und berechnet so die benötigte Insulinmenge. „Ändert sich der Blutzucker etwa aufgrund einer Erkrankung, passt die KI nach einer kurzen Lernphase automatisch die Insulindosis an. Das ist neu im Vergleich zu anderen Diabetes-Apps“, so Wuttke. „Je länger man die App nutzt, umso präziser werden die Hinweise.“
Woran wird geforscht?
Ob Anwender die vorgeschlagene Insulinmenge übernehmen, entscheiden sie selbst, wenn sie die Dosis in den Pen eingeben. Das Start-up aus der Biocity Leipzig arbeitet mit dem Elektroingenieur Dr. René Richter von der Technischen Universität Dresden zusammen. Er hat einen smarten Insulinpen entwickelt, der die tatsächlich gespritzte Dosis registriert und den Wert über Bluetooth an die App übermittelt. Zusätzlich prüft der Hightech-Pen über Temperatursensoren auch die Temperatur des Insulins. „Sollte eine kritische Temperatur, etwa unter null oder über 40 Grad erreicht werden, warnt die App ihre Benutzer“, erklärt Richter. Der Insulinpen soll in etwa zwei Jahren auf den Markt kommen.
Noch profitieren nur wenige Patienten und Ärztinnen von Anwendungen mit KI. Das möchte Dr. Narges Ahmidi vom Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme ändern. Die Leiterin der Abteilung Reasoned AI decisions (Begründete KI-Entscheidungen) erforscht, in welchen Bereichen – etwa Vorsorge, Früherkennung, Diagnose, Therapie und Nachsorge – künstliche Intelligenz sowohl Patientinnen und Patienten helfen als auch Fachleute unterstützen kann.
Eine Vision: mithilfe von KI das individuelle Risiko für Krankheiten wie zum Beispiel Krebs vorhersagen zu können, lange bevor diese ausbrechen. Ein weiterer Forschungsbereich: die personalisierte Medizin. Computer könnten in Zukunft noch mehr dazu beitragen, Behandlungspläne zu erstellen, die auf jeden Einzelnen optimal zugeschnitten sind. „Das ist dann möglich, wenn die künstliche Intelligenz aus Millionen von Personen mit einer ähnlichen Krankheitsgeschichte gelernt hat. Basierend auf diesem Wissen kann die KI gemeinsam mit dem Arzt oder der Ärztin genau die passende Therapie finden, die zu einer schnellstmöglichen Genesung führt“, sagt Forscherin Narges Ahmidi.
Warum ist mangelnde Digitalisierung problematisch?
Bevor „intelligente“ Computer auf diese Weise eingesetzt werden können, gibt es noch viele Hürden zu überwinden. Für Carsten Marr und Narges Ahmidi ist derzeit eines der größten Probleme die mangelnde Digitalisierung in Deutschland: Forschende haben kaum Zugriff auf Gesundheitsdaten und – falls vorhanden – sind diese selten in einem Format, mit dem die KI direkt arbeiten kann. Dabei enthalten die Forschungsdaten aus Kliniken oder Laboren keine Namen oder sonstige zuordenbare Patienteninformationen. „Wir hätten nie die Möglichkeit, Patienten anhand einzelner Zellen zu identifizieren“, sagt Marr. Außerdem gibt es nationale und EU-weite Initiativen, um Gesundheitsdaten bestmöglich vor Hackerangriffen und Missbrauch zu schützen.
Der nächste Schritt: Wenn man Daten und einen funktionierenden Algorithmus hat, dann muss er an vielen verschiedenen Datensätzen getestet werden. Funktioniert der Algorithmus weiterhin gut, ist die letzte Hürde die Zulassung als Medizinprodukt – ähnlich wie bei einem Medikament. Die gewährleistet, dass das System gut funktioniert und sicher ist.
Ist die Sorge berechtigt, dass bald ein KI-System die Diagnose stellt und Kranke keinen Arzt oder Ärztin mehr sehen? „Das passiert noch sehr lange nicht; vielleicht auch nie“, sagt Narges Ahmidi. Und Carsten Marr ergänzt: „Ich persönlich würde immer einen Arzt oder eine Ärztin haben wollen, mit denen ich bei schwierigen Entscheidungen reden kann.“ Wahrscheinlich ist jedoch, dass die KI in Zukunft einfache Routineaufgaben in der Medizin übernimmt. Aufgaben, die zeitintensiv und langweilig für Menschen sind: Arztbriefe schreiben, Termine vereinbaren, Daten aus dem Labor auswerten. Dank Unterstützung durch die KI bleibt in den Arztpraxen dann hoffentlich mehr Zeit für persönliche Gespräche mit den Patientinnen und Patienten.
Quellen:
- Helmholtz Munich: Computational Health Center. https://www.helmholtz-munich.de/... (Abgerufen am 01.06.2023)
- DelViscio J, Tabb M: Wie lernen Maschinen?. Spektrum: https://www.spektrum.de/... (Abgerufen am 29.06.2023)
- TU Dresden: Smarte Sensoren und selbstlernende KI-Software: Mit digitaler Technologie Diabetes sicherer behandeln. https://tu-dresden.de/... (Abgerufen am 29.06.2023)
- Fraunhofer IKS: Artificial Intelligence in Medicine. https://www.iks.fraunhofer.de/... (Abgerufen am 22.06.2023)
- Statista: Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen. Umfrage zu technischen Angeboten in deutschen Krankenhäusern im Jahr 2022. https://de.statista.com/... (Abgerufen am 28.06.2023)
- Open AI: Chat GPT. https://chat.openai.com/... (Abgerufen am 29.06.2023)