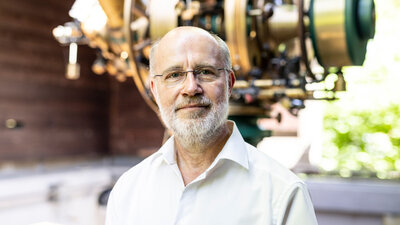Kommentar: Handeln für die Selbstachtung

„Niemand macht einen größeren Fehler als jener, der nichts tut, weil er glaubt, nicht viel bewirken zu können.“ (Nach Edmund Burke, Philosoph)
© W&B/Sylwia Kubus
Klimawandel – das Wort hörte ich zum ersten Mal am Lagerfeuer in einem wilden Garten. Ich muss etwa zehn Jahre alt gewesen sein. Meine fast erwachsene Freundin engagierte sich in der Umweltbewegung, ich bewunderte sie sehr. Sie erklärte mir den Treibhauseffekt, erzählte, dass die Erderwärmung nicht aufzuhalten sei, dass es wichtig wäre, den Temperaturanstieg zu begrenzen.
Damals, in den Achtzigern, im Schein des prasselnden Feuers, den Bauch vollgestopft mit Ofenkartoffeln, klang das mit dem Treibhauseffekt gar nicht schlecht. Schluss mit verregneten Sommern und grauen Novembertagen! In meiner Vorstellung sah ich mich als alte Frau zwischen Bananenstauden Cocktails aus einer Kokosnuss schlürfen. Es könnte schlimmer kommen, dachte ich damals.
Die Krise hat sich drastisch verschärft
Es kam schlimmer. Die ökologische Krise hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verschärft. In Europa herrschte dieses Jahr eine Rekorddürre. Starkregen hat etwa ein Drittel der Fläche Pakistans überflutet, in Deutschland stirbt der Wald. Ich erspare Ihnen und mir eine weitere Aufzählung von Katastrophen.
Dieser Text entsteht in einem Ferienhaus in Südfrankreich. Seit Monaten hat es hier nicht geregnet. Kiefern und Pinien sind abgebrannt, die sengende Hitze verwandelt fruchtbaren Boden in Wüste. Keine Feigen, keine Oliven, nicht einmal der hitzeerprobte Oleander blüht. Was mich zum Weinen bringt ist die dröhnende Stille. Die meisten Vögel und Insekten sind weg.
Die Zeit war da – jetzt läuft sie davon
Wann hat die Normalität aufgehört zu existieren? Und für wen? War es im September 2019, als Greta Thunberg und Millionen Jugendliche anfingen, gegen die Klimakrise zu demonstrieren? War es im Februar 2020, als die Pandemie die Welt lahmlegte? Oder erst, als Putin Europa in einen Krieg zwang und uns das Gefühl gab, wir hätten gerade dringendere Probleme als die Erderhitzung? Vielleicht vergeht die Normalität schon die ganze Zeit, ohne, dass wir es wahrhaben wollen. Mit jeder ausgestorbenen Tierart, mit jedem kranken Baum, jedem Temperaturrekord.
Sich mit der Zeit, die uns bevorsteht, auseinander zu setzen, macht Angst. Manchmal will ich mir lieber nicht so genau vorstellen, wie es sein wird, auf einem angezählten Planeten zu leben. Dabei hätten wir lange genug Zeit gehabt, uns auf den Klimawandel einzustellen. Bereits 1941 stellte der deutsche Klimaforscher Hermann Flohn als einer der ersten weltweit die These vom menschengemachten Klimawandel auf. Noch dreißig Jahre bevor der Club of Rome seinen Appell mit „Die Grenzen des Wachstums“ an die Weltgemeinschaft richtete.
Die ökologische Krise hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verschärft.
Verpasste Chancen
Ich kam in den Neunzigern erneut mit dem Thema Klimaschutz in Berührung. Ich engagierte mich beim Bund für Umwelt und Naturschutz. Der Verein veröffentlichte damals gemeinsam mit den Kirchen die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“, in der Lösungen für eine CO2-neutrale Energieversorgung skizziert wurden. Ein Mix aus Sonne, Wind und Wasserkraft, eine Dezentralisierung der Energieversorgung. Wenn wir es damals angepackt und unsere Energieversorgung Schritt für Schritt neu aufgestellt hätten, wären wir heute nicht abhängig von Putins Gas.
Damals interessierte sich außer ein paar „Ökospinnern“ niemand wirklich dafür, Lösungen für eine klimaneutrale Energieversorgung zu gestalten. Auch ich glaubte irgendwann, wichtigere Probleme zu haben. Meine Bafög-Schulden zurückzahlen, eine Haftpflichtversicherung abschließen, mich im Job beweisen. Erwachsenenkram.
Inzwischen gelingt mir das Verdrängen der Klimakatastrophe nur noch schlecht. Meine lange schwelende Angst vor dem, was auf meine Kinder zukommt, ist einer Trauer gewichen – um das, was wir für immer verlieren werden. Ich nehme seit Jahren Abschied. Abschied von den Fichten, die mein Großvater als junger Mann gepflanzt hat und deren tote Überreste nach mehreren Dürrejahren in meinem Ofen brennen. Abschied von den Gletschern, auf deren sterbenden Ausläufern ich im Sommer eine letzte Hochtour unternahm.
Und jetzt?
Lässt sich die Klimakatastrophe noch aufhalten? Haben wir überhaupt noch eine Chance, entscheidende Kipppunkte wie die Zerstörung des Amazonas zu stoppen? Was bringt es, wenn ich kein Fleisch mehr esse, die Heizung runterdrehe, Flugreisen meide? Zur Wahrheit gehört: trotz allem Engagement, trotz veganer Schinkenspicker, trotz Flugscham steigt der weltweite CO2-Austoß ungebremst. Weil nicht genug passiert, um die Abhängigkeit von fossiler Energie zu beenden. Die Kluft zwischen dem, was getan werden müsste und dem, was wir tun, war nie größer.
Meine scheinbare Machtlosigkeit hat mich lange umgetrieben. Wahrscheinlich gibt es auf die Frage nach Sinn und Sein in dieser existenziellen Krise keine wirklich gute Antwort. Doch zumindest für mich habe ich einen Weg gefunden, mit dem ich leben kann. Ich zerbreche mir nicht mehr den Kopf, ob das, was ich tue, etwas bringt, um die Katastrophe abzuwenden. Die Frage, die mir etwas bedeutet, lautet: Wer will ich sein in dieser Welt? Mir diese Frage zu stellen, ändert meine innere Haltung zur Krise. Antworten darauf zu finden schafft Handlungsoptionen, Wege aus der Ohnmacht.
Manchmal stelle ich mir vor, wie mir meine Kinder in 30 Jahren ins Gesicht brüllen: „Was hast du getan, um diese Scheiße zu verhindern? Damals, als es noch möglich war.“ Wenn ich darauf antworte, will ich ihnen in die Augen schauen können. Ja, ich bin ein kleines Licht. Aber ich kann etwas tun. Niemand macht einen größeren Fehler, als derjenige, der nichts macht, weil er glaubt, nur wenig tun zu können. Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern geht auf einen berühmten Philosophen zurück. Was ich tue? Unter anderem freitags gemeinsam mit meinen Kindern für Klimaschutz demonstrieren.