Gesundheit im vereinten Deutschland
Polikliniken, Gemeindeschwestern, Impfpflicht – mit der Wiedervereinigung 1990 gilt nicht nur das politische System der DDR als überholt, sondern auch dessen Gesundheitswesen. Im Schnelldurchlauf werden die alten Strukturen im Osten abgeschafft und neue aufgebaut – nach Vorbild des Westens. Ärzte sind nicht länger in staatlichen Ärztehäusern angestellt, sondern lassen sich in eigenen Praxen nieder. Statt unter staatlicher Kontrolle zu stehen, organisieren sie sich nun selbst in Ärztekammern. Krankenhäuser gelangen in die Hand von Kommunen, Kirchen und Privatunternehmern.
Doch bald zeigt sich: Viele medizinische Errungenschaften aus DDR-Zeiten können im Kern sehr nützlich sein. Aus der Idee der Polikliniken entwickelt sich das Konzept der medizinischen Versorgungszentren. Auf dem Land entstehen Modellprojekte, die den Beruf der Gemeindeschwestern wieder entdecken. Und mit der Impfpflicht für Masern wird die gesetzliche Regelung von Schutzimpfungen erneut ein Thema. Was hat sich seit der Wiedervereinigung im deutschen Gesundheitssystem getan?
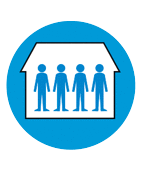
© W&B
Von der Poliklinik zum MVZ
"Alles unter einem Dach", so lautete die Devise der Polikliniken in der DDR. Hier praktizierten Ärzte verschiedener Fachrichtungen – vom Allgemeinmediziner bis zum Orthopäden – in einem Haus, teilten sich Ausrüstung und Patienten. Bis 1995 sollten die Polikliniken im geeinten Deutschland aus dem Gesundheitssektor verschwinden. 2004 erfuhr das Konzept ein Revival unter neuem Namen: medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). Inzwischen gibt es deutschlandweit über 1200 MVZs, und die Anstellung dort wird für viele Mediziner immer attraktiver: Zwischen 2012 und 2018 hat sich die Zahl der MVZ-Ärzte verdreifacht: von vier auf zwölf Prozent aller Mediziner.

© W&B
Gut ausgestattet?
In der DDR waren moderne medizinische Großgeräte wie Computertomografen (CT) Mangelware. So hatte man in den 1980er-Jahren nur einen CT für 600 000 Einwohner. Im Westen war das Verhältnis 1 : 100 000. Nach der Wende holte der Osten auf. 1997 lag die Zahl der CTs je Einwohner in den neuen Bundesländern mit 1 : 63 488 nur knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 1 : 58 013. Heute kommen bundesweit auf einen CT rund 14 000 Einwohner.
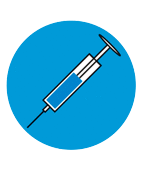
© W&B
Pflicht oder nicht?
Kaum ein Thema polarisiert in Deutschland wie dieses: Impfen. Mit der Wende wurde die im Osten geltende Impfpflicht abgeschafft. Rund 20 Schutzimpfungen waren für Kinder in der DDR bis dato gesetzlich vorgeschrieben. Seit März 2020 kommen auch Kita- und Schulkinder in der BRD an einem Pikser nicht mehr vorbei: der Masernimpfung.
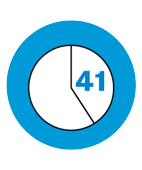
© W&B
Privatsache
Anfang der 1990er-Jahre wurden viele ehemalige Staatskrankenhäuser in Ostdeutschland von privaten Investoren aufgekauft. Diese Privatisierungswelle wirkt bis heute nach: Noch immer ist der Anteil privater Kliniken an Krankenhäusern im Osten mit 41 Prozent höher als im Westen mit 36 Prozent.
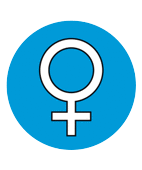
© W&B
Frauendomäne
Dass Frauen berufstätig sind und Karriere machen, stieß in der DDR auf eine gesellschaftlich höhere Akzeptanz als in der BRD. Die Gesundheitsbranche bildete keine Ausnahme. Heute praktizieren im Osten sogar mehr Ärztinnen als Ärzte. In den alten Bundesländern liegt der Frauenanteil bei unter 50 Prozent. Einzige Ausnahme: Hamburg.

© W&B
Mangelware Arzt
Der Ärztemangel ist ein gesamtdeutsches Problem, in den neuen Bundesländern allerdings ein größeres als in den alten. So hat ein Arzt im Osten durchschnittlich 228 Menschen zu versorgen, ein Arzt im Westen nur 214. Der Unterschied lässt sich jedoch weniger historisch begründen als vielmehr strukturell: Ostdeutschland ist sehr ländlich geprägt. Auf dem Land mangelt es deutschlandweit stärker an Ärzten als in den Städten.
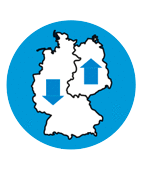
© W&B
Apothekenzahl
Zur Wende deckten 2465 Apotheken den Arzneimittelbedarf der Menschen in den neuen Bundesländern. Im Westen waren es zu dieser Zeit 17 433. Bis 2018 erhöhte sich die Apothekenzahl im Osten auf 3871 – im Westen sank sie dagegen auf 15 552.



