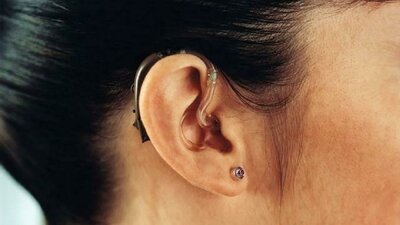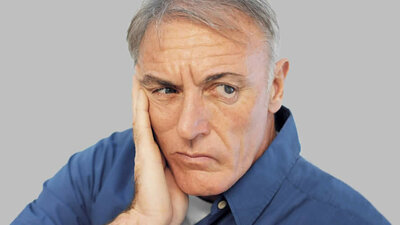Ohrenschmerzen-Diagnose: Wie der Arzt vorgeht

Wenn es im Ohr schmerzt: Der Arzt untersucht den äußeren Gehörgang mit dem Ohrspiegel
© DPA Picture Alliance/BOISSONNET
Mediziner sprechen von primärer Otalgie, wenn die Ursache für Ohrenschmerzen in den Ohren selbst liegt. Befinden sich die Auslöser in angrenzenden Strukturen oder in Bereichen, die über Nervenbahnen und Muskelstränge mit dem Ohr verbunden sind, handelt es sich um sekundäre Otalgien.
Muskelverspannungen setzen sich dann zum Beispiel fort, gereizte Nervenfasern leiten die Schmerzen vom ursprünglichen Krankheitsherd zum Ohr. Oder Wucherungen drücken auf Ohranteile.
Wegweisend bei Ohrenschmerzen: Patientengespräch und Krankengeschichte
Zuerst befragt der Arzt, in der Regel der Hausarzt, der Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder der Kinderarzt, seinen Patienten. Er will wissen, wie und wo der Schmerz sich äußert, ob er in einem oder beiden Ohren auftritt, wie er eingesetzt hat und wie er aktuell verläuft.
Bei Säuglingen und Kleinkindern sind es die Eltern oder Begleitpersonen, die Verhalten und Zustand des Kindes beschreiben können. Säuglinge fassen sich an das erkrankte Ohr, sind weinerlich, reizbar, wirken allgemein krank und haben oft Fieber. Nicht selten klagen Kinder auch über Bauchschmerzen, obwohl eigentlich die Ohren die Krankheitsursache sind.
Wichtige Anhaltspunkte geben dem Arzt zudem Begleitsymptome wie Hörprobleme, Juckreiz, Ausfluss aus dem Ohr, Ohrgeräusche, Schwindel, allgemeines Krankheitsgefühl, Unruhe, Reizbarkeit.
Aufschlussreich sind außerdem zusätzliche Schmerzen und Beschwerden in anderen Körperteilen, etwa im Gesicht, Kopf oder Hals- und Schulterbereich. Der Arzt fragt darüber hinaus nach vorausgegangenen oder gerade akuten Infekten, nach früheren Ohrerkrankungen sowie nach bestehenden Grunderkrankungen.
Dazu gehören zum Beispiel Allergien, Diabetes, chronische Atemwegserkrankungen. Auch mehr über Gewohnheiten und Lebensumstände des Patienten zu wissen kann für ihn von Interesse sein. Etwa ob der Betroffene raucht, Alkohol trinkt, unter Stress steht, häufig in kühlem Wasser schwimmt, in lauter Umgebung tätig ist und vieles mehr.
Körperliche Untersuchung bei Ohrenschmerzen
Der Arzt untersucht anschließend das äußere Ohr sowie den Kopf- und Halsbereich eingehend. Durch Abtasten und durch bestimmte Griffe kann er oft schon Ort und Art des Schmerzes feststellen, etwa Druckschmerzen hinter dem Ohr, Nerven- oder Muskelschmerzen.
Dann betrachtet er Gehörgang und Trommelfell genauer mit einem speziellen Ohrenspiegel (Otoskop) beziehungsweise einem Untersuchungsmikroskop. Dabei erkennt er meist deutlich Trommelfellverletzungen und Entzündungszeichen im Gehörgang oder (indirekt) im Mittelohr. Einen Ohrschmalzpfropf oder Fremdkörper entfernt der Arzt meist gleich, zum Beispiel mit einem Ohrhäkchen.
Das Mittelohr kann er zwar nicht direkt einsehen, aber die Beschaffenheit des Trommelfells und seiner Umgebung geben ihm Hinweise auf entzündliche Vorgänge im Mittelohrraum.
Ein Blick in den Mund und Rachen sowie in den Nasen-Rachen-Raum zeigt ihm mögliche Schwellungen, Entzündungsherde oder Gewebeveränderungen. Auch bestehende Kieferprobleme fallen häufig bei der ersten Prüfung auf.
Weitere hilfreiche Untersuchungsschritte, um mögliche Ursachen von Ohrenschmerzen aufzudecken
Je nach Verdacht können Laboranalysen angezeigt sein, etwa ein Abstrich von eitrigem Sekret, um Erreger zu bestimmen, oder Bluttests, um bestimmten Entzündungen wie einer Schilddrüsenentzündung nachzugehen.
Wenn Diagnose und Krankheitsentwicklung es nahelegen, folgen entsprechend weitere Untersuchungen, etwa bei einem Neurologen, einem Orthopäden, einem Kieferorthopäden, Zahnarzt oder Internisten.
Bildgebende Verfahren kommen hauptsächlich infrage, wenn der Arzt mögliche Komplikationen vermutet. So kann sich etwa im Rahmen einer Mittelohrentzündung eine Mastoiditis entwickeln, wenn die Entzündung die Knochenstruktur des Warzenfortsatzes oder zusätzlich auch Felsenbein und Jochbogen ergriffen hat. Eine Computertomografie gibt dann Aufschluss. Auch für die Diagnose von Tumoren und deren Ausbreitung veranlasst der Arzt häufig weitere Spezialuntersuchungen, zum Beispiel eine Spiegeluntersuchung des Kehlkopfs, eine Laryngoskopie, sowie Computer- oder Magnetresonanztomografien oder Ultraschalluntersuchungen.
Hörtests bei anhaltenden Ohrbeschwerden
Der HNO-Arzt wird das Hörvermögen prüfen, wenn der Verdacht besteht, dass auch das Innenohr mit betroffen ist. Auch wenn die Schmerzen länger bestehen oder immer wieder auftreten, sind Hörtests angezeigt. Das kann zunächst eine einfache Stimmgabelprüfung sein. Sogenannte audiometrische Untersuchungen mit elektronischen Prüfgeräten erlauben es, nötigenfalls die Hörstörung genauer zu bestimmen.
Mit Hilfe der Hirnstammaudiometrie lassen sich Nervenaktivitäten im Innenohr und Teilen des Gehirns überprüfen. Auch ist es damit möglich, Nervenerkrankungen auf die Spur zu kommen. Mehr Informationen zu Gehörprüfungen finden Sie auch im Symptome-Beitrag "Schwerhörigkeit" (Abschnitt "Diagnose"):
Der Diagnose von Haus- oder Kinderarzt beziehungsweise der entsprechenden Fachärzte folgend richtet sich die anschließende Behandlung nach der jeweiligen Ursache. Bei Unfällen, Verletzungen, komplizierten Entzündungsprozessen sowie Tumoren ist in der Regel eine sofortige beziehungsweise rasche Therapie in einer Klinik notwendig.