Krebs: Was das Wort bedeutet
Hier erfahren, Sie, was Krebs eigentlich ist, erhalten Tipps zum Umgang mit der Krankheit und weitere Informationen. zum Artikel

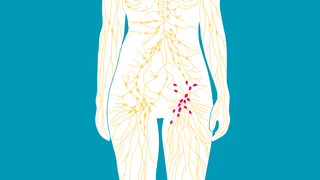

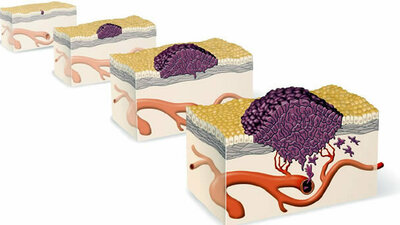
Krebs: Was das Wort bedeutet
Hier erfahren, Sie, was Krebs eigentlich ist, erhalten Tipps zum Umgang mit der Krankheit und weitere Informationen. zum Artikel












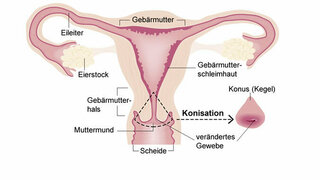

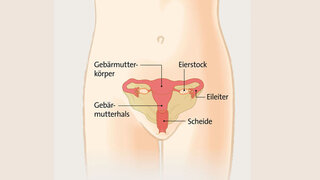




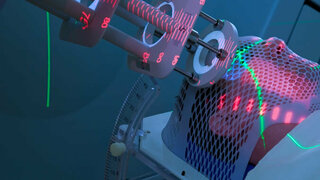

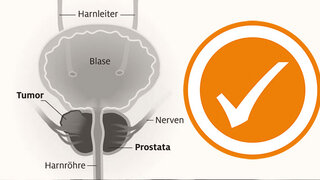




Die Anzeige der externen Inhalte wurde von Ihnen im Consent abgewählt.
Wollen Sie die Inhalte doch angezeigt bekommen?