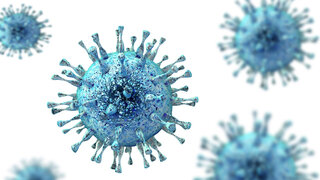„Die Apotheke ist der Fels in der Brandung“

Kürzlich wurde die Apothekerin Gabriele Regina Overwiening zur neuen Präsidentin der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. gewählt. Sie leitet eine Apotheke im westfälischen Reken und zwei Filialen und kennt die Sorgen und Nöte der Patienten
© W&B/Andreas Müller
Frau Overwiening, was ist Ihr größtes Ziel für die kommenden vier Jahre?
Wir Apotheker wollen der Bagatellisierung der Arzneimittel entgegenwirken: Medikamente sind keine Bonbons. Sie sind starke Helfer gegen Krankheiten, haben aber auch ein Gefährdungspotenzial. Wenn man sich die gesellschaftliche Entwicklung anschaut, dann werden heute Arzneimittel etwa in der Werbung und bei manchen politischen Entscheidern eher gehandhabt wie eine beliebige Ware, bei der nur ein möglichst günstiger Preis zählt. Das geht natürlich nicht. Arzneimittel sind das Kernstück fast jeder medizinischen Therapie und deshalb von ungeheurem Wert. Das ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, ist unser ganz großes Ziel der nächsten Jahre. Wir wollen die beste und sicherste Therapie bieten.
Wie wollen Sie das schaffen?
Etwa indem wir für Patienten einen Medikationsplan erstellen oder den vorhandenen aktualisieren. Wir analysieren zum Beispiel genau, ob die Arzneimittel, die der Patient einnimmt, Wechselwirkungen verursachen. Bei jeder Arznei, die von einem anderen Arzt verschrieben wird oder die der Patient selbst kauft, muss wieder geschaut werden, ob noch alles zusammenpasst. Das ist sehr aufwändig. Im Moment ist nur jeder 16. Medikationsplan ohne Fehler oder Probleme. Hätten alle Menschen, die mehrere Arzneimitteln einnehmen, einen funktionierenden Medikationsplan, ging es allen besser. Sie wüssten dann genau, welches Medikament sie wann, wie und warum einnehmen sollten.

Gabriele Regina Overwiening im Gespräch
© W&B/Andreas Müller
Wie soll diese Beratung finanziert werden?
Über das kürzlich beschlossene Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz haben wir Apotheker die Möglichkeit, pharmazeutische Dienstleistungen – ein Beispiel dafür ist die Analyse des Medikationsplans – mit den Krankenkassen zu verhandeln und ein Honorar dafür zu bekommen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das Arzneimittel wird nämlich nur gepaart mit der richtigen Dienstleistung zu einem starken Helfer. Die Menschen brauchen verlässliche und persönliche Ansprechpartner in der Arzneimitteltherapie. Wir können uns dann noch mehr Zeit für die Patienten nehmen. Wir retten damit Leben. Jeden Tag!
Wie hilft die Digitalisierung in Zukunft?
Wir wollen die Digitalisierung so einsetzen, dass sie die Patienten bei der Therapie und uns bei der Arbeit unterstützt. Moderne Anwendungen werden zunehmend eine Rolle spielen. Auf den Medikationsplan können zum Beispiel Ärzte und Apotheker zugreifen und der Patient hat ihn künftig auf dem Smartphone immer bei sich. Mithilfe von Daten können wir den Menschen in Deutschland, die immer älter werden und komplexere Therapien brauchen, besser helfen. Ein Beispiel: Vielleicht schafft es ein herzkranker Patient gar nicht mehr zu mir in die Apotheke. Aber wenn er auf seine Waage geht, wird mir sein Gewicht digital übermittelt. Ein höheres Gewicht als an den Tagen davor bedeutet, dass eventuell die Dosis seiner Entwässerungstabletten erhöht werden muss. Ich nehme Kontakt auf und ändere in Rücksprache mit dem Arzt für die Woche die Dosierung der Entwässerungstabletten.
2022 soll das elektronische Rezept flächendeckend eingeführt werden. Was verändert sich dadurch?
Praktisch wird das so laufen: Die Patienten bekommen beim Arzt einen QR-Code, der im Handy gespeichert oder ausgedruckt wird. Das ist der Schlüssel, den man dem Apotheker gibt, damit er an das Rezept herankommt. Man kann ihn digital übermitteln oder persönlich in die Apotheke bringen. Wer nicht kommen kann, kann sich das Medikament vom Botendienst liefern lassen. So oder so hat der Patient immer persönliche Ansprechpartner. Da ändert sich nichts. Durch die Digitalisierung haben wir einfach mehr Werkzeuge an der Hand, um dem Patienten zu helfen.
Eines Ihrer großen Themen ist eine bessere Zusammenarbeit mit Ärzten. Wie stellen Sie sich das vor?
Wenn wir mehr Arzneimitteltherapiesicherheit erreichen wollen, brauchen wir das Gespann Arzt und Apotheker in gemeinsamer Zielsetzung für den Patienten. Aber da sind sich Ärzte und Apotheker einig, das geht nur gemeinsam. Wir müssen uns wie ein therapeutisches Team kurzschließen. Durch die digitale Welt, die elektronische Patientenakte zum Beispiel, gibt es viele Möglichkeiten, wie wir uns vernetzen können. Das löst auch das Problem, dass Arzt und Apotheker aufgrund ihrer unterschiedlichen Arbeitsabläufe oft Schwierigkeiten haben, sich telefonisch zu erreichen.
Ein zentrales Thema von Ihnen ist auch, die Apotheke vor Ort zu stabilisieren. Haben Sie Angst davor, dass der Versandhandel zunimmt und örtliche Apotheken verdrängt?
Wenn wir bei den Menschen ins Bewusstsein bringen können, wie wichtig Apotheken sind, dann habe ich keine Angst. Die Patienten entscheiden letztendlich, ob es die Apotheke vor Ort gibt. Unsere Infrastrukturen werden vom Verhalten der Menschen bestimmt. Wir müssen ihnen klar machen, dass die Apotheke nur weiter existieren kann, wenn sie auch regelmäßig genutzt wird. Im Internet regelmäßig benötigte Medikamente bestellen, dann aber im Notdienst Schmerzmittel holen – das ist unsolidarisch. Die Patienten sollten auch nicht auf falsche Versprechungen aus dem Netz reinfallen. Sie können aber gerne damit in die Apotheke kommen und mit uns darüber reden. Wir sollten uns alle bewusst machen, welchen Schatz wir haben: eine Versorgung durch die Apotheken 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, überall. Es gibt kein besseres System. Das hat die Coronakrise gezeigt.
Welche praktischen Vorteile der örtlichen Apotheke sehen Sie noch?
Schneller als über die Apotheke kommt man nicht an ein Medikament. Wenn das Medikament nach Hause geliefert werden soll, kommt noch am selben Tag ein geschulter Bote von uns, also eine PTA oder ein Apotheker, der auch noch kompetent berät. Das ist anders, als wenn ein Versandhandelspaket mit Medikamenten vielleicht beim Nachbarn abgegeben wird und die Kinder schon mal schauen, was da für schöne rote Pillen drin sind. Es gibt zwei Systeme: ein sicheres und ein unsicheres. Eines, was Gemeinwohlaufgaben übernimmt und eines, was das nicht tut. Und wenn Menschen sich für eine gute und sichere Therapie entscheiden wollen, bleibt ihnen nur die Apotheke vor Ort.

Gabriele Regina Overwiening im Interview mit Hauptstadtkorrespondentin Tina Haase
© W&B/Andreas Müller
Wie sind die Apotheker bisher durch die Coronakrise gekommen?
Apotheken haben sich tapfer gehalten, sind die ganze Zeit am Netz geblieben, haben wirksame Maßnahmen zum Infektionsschutz ergriffen und ihr Personal gut geschult. Es wurden Plexiglasscheiben eingebaut und Wegeleitsysteme umgesetzt. Wir waren sehr schnell mit allem. Auch Desinfektionsmittel haben wir hergestellt, als kein industriell produziertes mehr da war. Wir haben Masken besorgt und die Menschen aufgeklärt. Die Apotheke ist wie ein Fels in der Brandung.
Wissen das die Patienten zu schätzen?
Zumindest viele. An einem Morgen im April haben wir ein riesengroßes mit Kreide gemaltes "Danke" vor unserer Apotheke vorgefunden. Auch wertschätzende Worte, Schokolade und Blumensträuße erreichen uns. Extrem dankbar sind die Menschen über die Botendienste. Die haben in der Coronakrise zugenommen. Zeitweise auf 450000 am Tag.
Lieferschwierigkeiten haben in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Wie gehen Sie damit um?
In der Pandemie hat uns die Politik wegen der Engpässe vorübergehend die Möglichkeit gegeben, mehr individuell zu entscheiden. Das heißt, wenn ein Medikament nicht lieferbar war, hatte die Apotheke die Gelegenheit ein anderes abzugeben, auch wenn die Krankenkasse dafür keinen Rabattvertrag hatte. Das hat unfassbar geholfen. Diese Freiheit brauchen wir auch nach der Krise weiterhin. Es kann doch nicht sein, dass wir die Patienten nur wegen bürokratischer Vorgaben unversorgt lassen.
Und wie begegnen Sie den Engpässen? Was muss sich ändern?
Wenn nur ein Unternehmen in Südostasien einen bestimmten Wirkstoff herstellt, und es fällt eine Produktionsanlage aus, oder es gibt qualitative Probleme, haben auch die Arzneimittelhersteller in Europa einen kompletten Ausfall. Wesentliche Wirkstoffe und Medikamente müssen wieder in Europa produziert werden. Zudem sollten die Krankenkassen mit unterschiedlichen Herstellern Rabattverträge abschließen, die ihre Ausgangsstoffe auch aus verschiedenen Firmen beziehen. Das streut das Risiko.
Wie läuft die Ausgabe der FFP2-Masken?
Sehr gut. Die Apotheken konnten in der kurzen Zeit schon einige Millionen Menschen mit Masken ausstatten. Die Patienten sind überwiegend sehr dankbar und glücklich. Es gab natürlich Warteschlangen und ein wenig Chaos. Ich habe aber bis jetzt nur geduldige Menschen erlebt. Es ist ja auch ein tolles Angebot, das der Staat hier mithilfe der Apotheken macht.
Was halten Sie davon, in der Apotheke gegen Grippe zu impfen?
Es gibt in mehreren Bundesländern Modellprojekte zur Grippeimpfung in Apotheken. In der Apotheke zu impfen ist eine gut nachvollziehbare Idee des Gesundheitsministers gewesen. In Ländern, in denen Apotheken impfen, ist die Impfquote höher als bei uns. Die Impfquote bei uns ist schlecht. Wir haben Jahre gehabt, in denen Tausende Menschen infolge einer Grippe verstorben sind. Es ist wichtig, dass wir helfen, die Impfquote zu erhöhen. Wir haben eine andere Klientel an Impflingen als in Arztpraxen. Apotheken sind leichter zugänglich und haben viel breitere Öffnungszeiten. Da kann man sich auch Samstagmorgen oder Freitagnachmittag die Impfung holen, wenn die Arztpraxen geschlossen sind. Ich glaube irgendwann wird das etabliert sein.
Könnte das mit der Covid-19-Impfung genau so kommen?
Von meiner Seite sehr gerne. Aber wir haben es hier mit einem neuen Erreger und einer neuen Impfung zu tun. Wir müssen erst mal sehen, welche Impfquoten man über die Impfzentren und die Arztpraxen erreicht. Sollten sie nicht hoch genug sein, wäre zu überlegen, ob auch in Apotheken geimpft wird. Wir brauchen aber erst mal Felderfahrung.